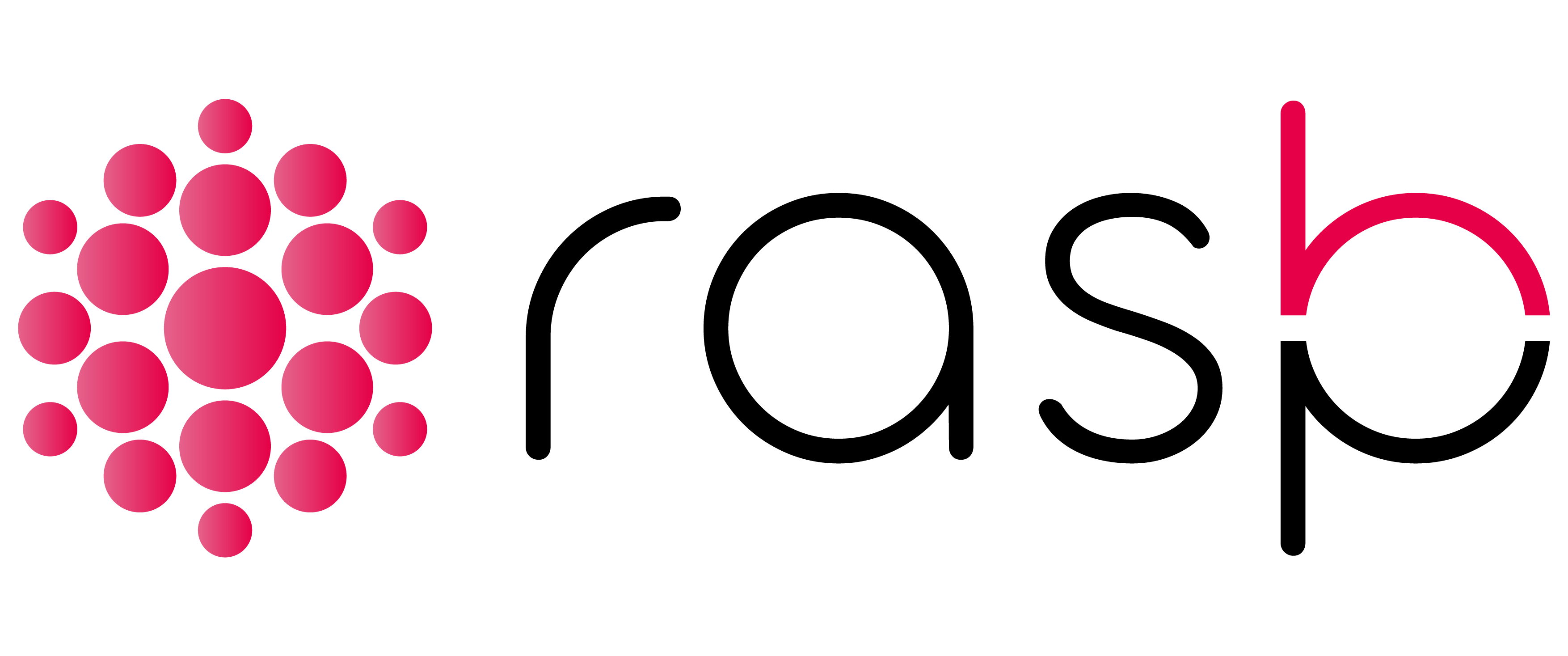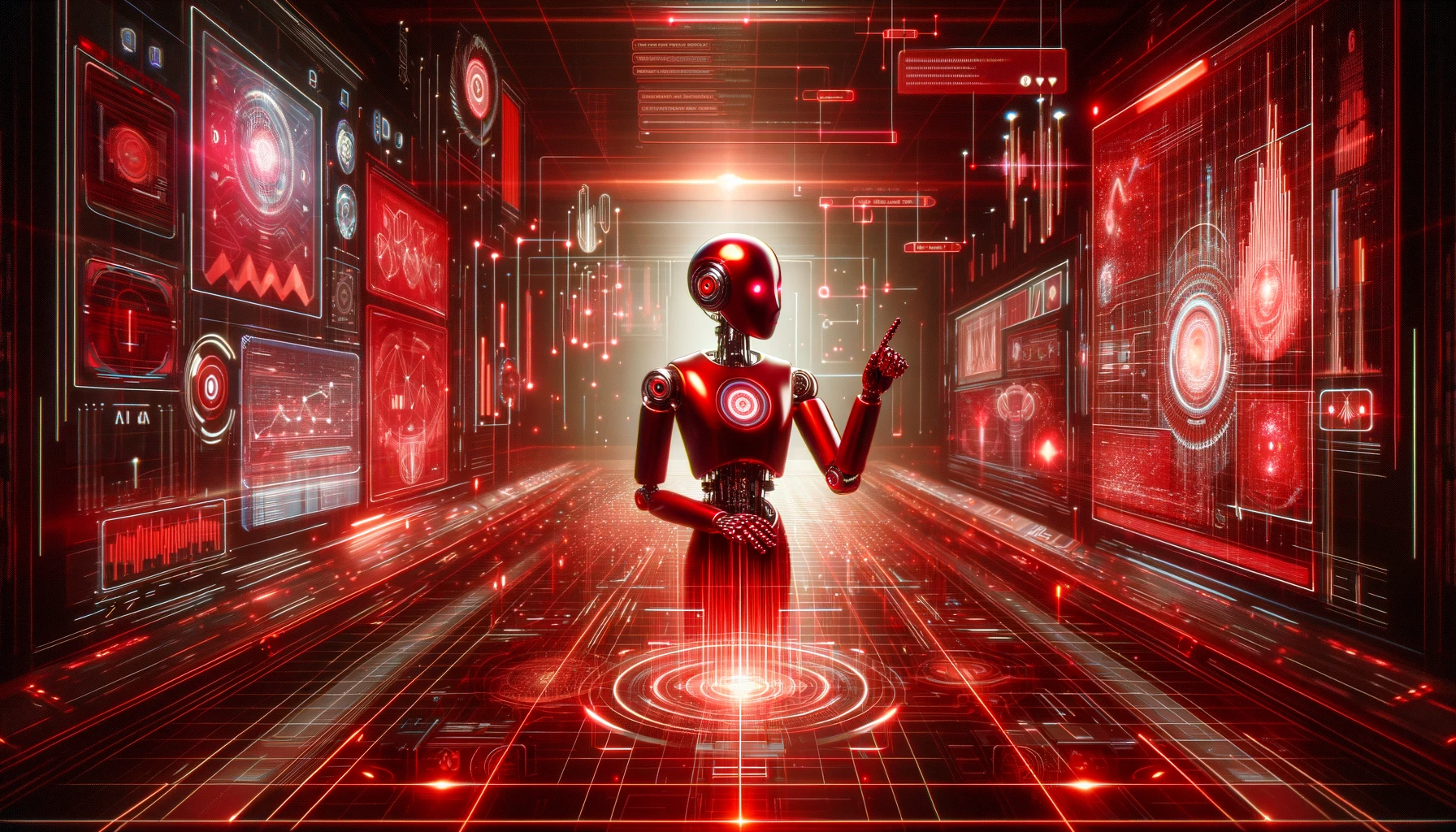Wir stellen die sechs transformativen Herausforderungen des EIC Accelerator 2024 vor
Der European Innovation Council (EIC) Accelerator steht an der Spitze des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts und treibt Innovationen in verschiedensten Sektoren voran. In seinem jüngsten Vorhaben hat der EIC sechs Challenges vorgestellt, die jeweils auf kritische Entwicklungs- und Forschungsbereiche abzielen. Diese Challenges zielen nicht nur darauf ab, die Grenzen der Technologie zu erweitern, sondern auch einige der dringendsten Probleme anzugehen, mit denen unsere Gesellschaft heute konfrontiert ist. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Diese Challenge konzentriert sich auf die Entwicklung von generativen KI-Technologien mit einem menschenzentrierten Ansatz. Sie betont die ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte der KI und stellt sicher, dass diese bahnbrechenden Technologien mit einem Fokus auf Menschenrechte, Demokratie und ethische Grundsätze entwickelt werden. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Engagement der Europäischen Union für digitale Innovationen, die grundlegende menschliche Werte respektieren. 2. Ermöglichung virtueller Welten und erweiterter Interaktion für Industrie 5.0 Diese Challenge zielt auf den Bereich Industrie 5.0 ab und will Virtual- und Augmented-Reality-Technologien voranbringen. Diese Technologien werden industrielle Anwendungen revolutionieren, indem sie das Benutzererlebnis und die Interaktion verbessern und so maßgeblich zum Fortschritt in einem vernetzteren und technologisch fortgeschritteneren Industriezeitalter beitragen. 3. Aktivierung der Smart Edge- und Quantentechnologiekomponenten Mit dem Fokus auf modernste Computer- und Kommunikationssysteme dreht sich dieser Wettbewerb um die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit Smart Edge Computing und Quantenkomponenten. Er erkennt die wachsende Bedeutung von Quantentechnologie und Edge Computing für die Gestaltung der Zukunft der Datenverarbeitung und Kommunikation an. 4. Lebensmittel aus Präzisionsfermentation und Algen Dieser Wettbewerb befasst sich mit innovativen Ansätzen für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und konzentriert sich auf Präzisionsfermentationstechniken und die Verwendung von Algen. Er zielt darauf ab, die Lebensmittelindustrie durch die Erforschung nachhaltigerer, effizienterer und umweltfreundlicherer Methoden der Lebensmittelproduktion zu revolutionieren und so zur globalen Ernährungssicherheit beizutragen. 5. Auf monoklonalen Antikörpern basierende Therapeutika für neue Varianten neu auftretender Viren Als Reaktion auf die sich entwickelnde Natur von Viruserkrankungen zielt dieser Wettbewerb auf die Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Behandlungen für neu auftretende Viren ab, mit besonderem Augenmerk auf neuen und variierenden Stämmen. Diese Initiative ist im Kampf gegen Pandemien und neu auftretende virale Bedrohungen von entscheidender Bedeutung und unterstreicht die Notwendigkeit agiler und adaptiver medizinischer Lösungen. 6. Erneuerbare Energiequellen und ihre gesamte Wertschöpfungskette Diese Herausforderung umfasst die gesamte Wertschöpfungskette erneuerbarer Energiequellen, von der Materialentwicklung bis zum Recycling von Komponenten. Sie unterstreicht die Notwendigkeit nachhaltiger Energielösungen, die jeden Aspekt des Lebenszyklus erneuerbarer Energien berücksichtigen, und verstärkt das Engagement der EU für ökologische Nachhaltigkeit und grüne Technologie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sechs Herausforderungen des EIC Accelerator ein vielfältiges und ehrgeiziges Zielpaket darstellen, das darauf abzielt, Innovationen voranzutreiben und wichtige globale Herausforderungen anzugehen. Von KI und virtueller Realität bis hin zu nachhaltiger Lebensmittelproduktion und erneuerbarer Energie spiegeln diese Herausforderungen das Engagement des EIC wider, eine technologisch fortschrittliche, nachhaltige und menschenzentrierte Zukunft zu gestalten. 1. Menschenzentrierte generative KI in Europa: Innovation mit Ethik und Gesellschaft in Einklang bringen Das Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) hat eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet und die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und interagieren, verändert. Die rasche Entwicklung und Einführung von KI-Technologien, insbesondere der generativen KI, hat jedoch erhebliche ethische, rechtliche und gesellschaftliche Bedenken aufgeworfen. Europa steht mit seinem Fokus auf menschenzentrierte KI an vorderster Front bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und ist bestrebt, sicherzustellen, dass die KI-Entwicklung mit ethischen Grundsätzen und gesellschaftlichen Werten in Einklang steht. Der europäische Ansatz für menschenzentrierte KI Der europäische Ansatz für KI ist tief in seinem Engagement für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verwurzelt. Die Europäische Union (EU) betont die Bedeutung der Entwicklung einer KI, die vertrauenswürdig und ethisch ist und die Grundrechte respektiert. Dieser Fokus zeigt sich in verschiedenen Initiativen und Strategien, wie dem Programm „Digitales Europa“, das darauf abzielt, die strategischen digitalen Fähigkeiten der EU zu verbessern und den Einsatz digitaler Technologien, einschließlich KI, zu fördern. Zu den wichtigsten europäischen Strategien für KI und digitale Transformation gehören die Integration der Bildung, um den Bürgern die Fähigkeiten zu vermitteln, die Fähigkeiten von KI zu verstehen, und die Umsetzung von Methoden zur Bewältigung von Übergängen in der Belegschaft. Diese Strategien unterstützen grundlegende und zielorientierte Forschung und schaffen ein starkes und attraktives Umfeld, das Talente in Europa anzieht und hält. Das Engagement der EU für ethische KI zeigt sich auch in der Gründung verschiedener KI-Forschungsnetzwerke wie CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media und ELISE, die darauf abzielen, den menschenzentrierten Ansatz für KI in Europa zu fördern. Die Europäische Kommission hat außerdem Initiativen wie den Europäischen Forschungsrat und AI Watch ins Leben gerufen, um die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Lösungen zu fördern und zu überwachen. Die Rolle der generativen KI in Europa Generative KI, die Technologien wie große Sprachmodelle und Bildgenerierungstools umfasst, gewinnt in Europa schnell an Bedeutung. Diese Technologie hat das Potenzial, Branchen zu revolutionieren, indem sie die Kundenbindung personalisiert, das Kundenerlebnis verbessert und neue Produkte und Dienstleistungen schafft. Sie bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie etwa den potenziellen Missbrauch personenbezogener Daten und die Erstellung schädlicher Inhalte. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, werden europäische Unternehmen und Forscher ermutigt, Leitplanken zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher zu errichten und sicherzustellen, dass die von der KI generierten Inhalte sicher und respektvoll sind. Dieser Ansatz steht im Einklang mit Europas starkem Schwerpunkt auf Privatsphäre und Datenschutz, wie er in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verankert ist. Ethische und gesellschaftliche Überlegungen Europas Fokus auf menschenzentrierte KI erstreckt sich auf die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der KI-Entwicklung. Die EU hat verschiedene Plattformen und Think Tanks wie PACE (Participactive And Constructive Ethics) in den Niederlanden eingerichtet, um ethische KI-Anwendungen zu fördern. Diese Plattformen bringen Unternehmen, Regierungsbehörden, Kompetenzzentren und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen, um die Entwicklung menschenzentrierter KI zu beschleunigen. Die EU-Ethikrichtlinien für KI skizzieren kritische Bedenken und rote Linien bei der KI-Entwicklung und betonen, wie wichtig es ist, menschliche Interessen in den Mittelpunkt der KI-Innovation zu stellen. Diese Richtlinien behandeln Themen wie Bürgerbewertungen und die Entwicklung autonomer Waffen und plädieren für starke politische und regulatorische Rahmenbedingungen, um diese kritischen Bedenken zu bewältigen. Die Zukunft der KI in Europa Europas Engagement für ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte der KI positioniert das Land als potenziellen globalen Marktführer auf diesem Gebiet. Indem es sich auf menschenzentrierte KI konzentriert, kann Europa … Mehr lesen