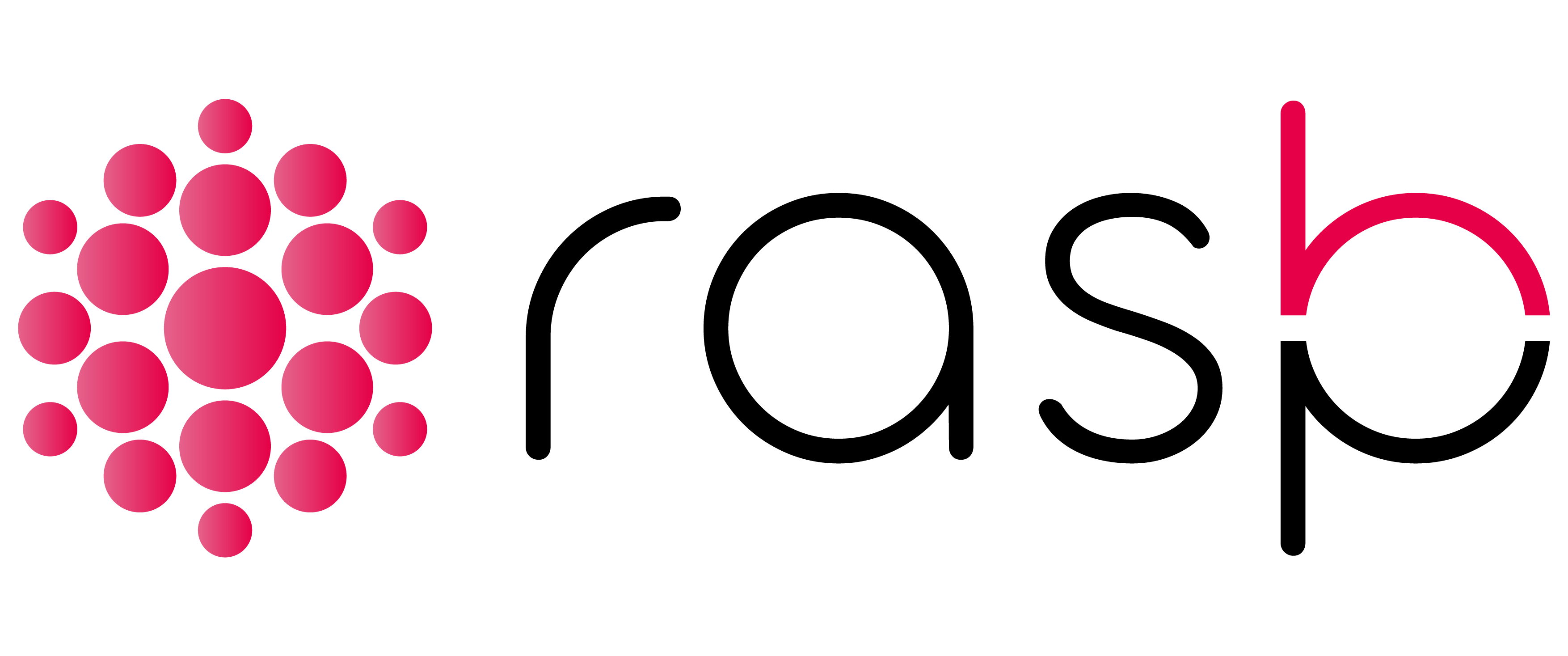EU-Innovationsfonds 2025–2026: Antragsleitfaden, Fristen & Erfolgstipps
Der EU-Innovationsfonds ist eines der weltweit größten Förderprogramme für innovative, saubere Technologien und zielt darauf ab, Netto-Null-Lösungen in großem Maßstab auf den Markt zu bringen. Finanziert durch Einnahmen aus dem EU-Emissionshandelssystem (ETS) unterstützt er innovative Projekte, die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren und Europa helfen, Klimaneutralität zu erreichen. Dieser Überblick erklärt, was der Innovationsfonds ist, wer sich bewerben kann, wie der Bewerbungsprozess abläuft und bietet Orientierungshilfe – von wichtigen Fristen 2025 und 2026 bis hin zu Tipps für die Erstellung eines überzeugenden Innovationsfondsantrags. Egal, ob Sie sich selbst bewerben oder einen Berater oder Antragssteller beauftragen, diese Einblicke helfen Ihnen, den Prozess zu meistern und Ihre Erfolgschancen zu verbessern.
Was ist der EU-Innovationsfonds?
Der EU-Innovationsfonds vergibt großzügige Zuschüsse für die Einführung innovativer Netto-Null-Technologien im industriellen Maßstab und wird durch das EU-EHS finanziert. Der Innovationsfonds ist ein klimaorientiertes Finanzierungsprogramm der Europäischen Kommission (GD CLIMA) zur Finanzierung der Demonstration und Skalierung innovativer kohlenstoffarmer Technologien. Es tritt die Nachfolge des früheren Programms NER300 an und soll bis 2030 rund 38 Milliarden Euro für zukunftsweisende Dekarbonisierungsprojekte bereitstellen. Anders als herkömmliche F&E-Fördermittel (z. B. Horizont Europa) dient der Innovationsfonds nicht der Grundlagenforschung, sondern zielt auf Projekte in der Pilot-, Demonstrations- oder ersten industriellen Einsatzphase ab und schließt so die Lücke zur kommerziellen Rentabilität. Indem er bis zu 60% der relevanten Projektkosten übernimmt (mit Zuschüssen in Höhe von Millionen bis Hunderten Millionen Euro), hilft er Unternehmen, hohe Vorlaufkosten und Risiken zu überwinden und ermöglicht ihnen, innovative Klimalösungen schneller auf den Markt zu bringen.
- Zweck: Ziel des Fonds ist es, deutliche Treibhausgasreduktionen (THG) in schwer reduzierbaren Sektoren voranzutreiben und gleichzeitig die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Er unterstützt Projekte in Bereichen wie erneuerbare Energien, Energiespeicherung, energieintensiven Industrien (wie Stahl, Zement, Chemie), Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS), Wasserstoff, nachhaltigen Kraftstoffen und anderen bahnbrechenden sauberen Technologien. Durch Investitionen in diese einzigartigen Projekte will der Innovationsfonds den Weg zu einem klimaneutralen Europa bis 2050 ebnen, im Einklang mit dem europäischen Green Deal und dem Net-Zero Industry Act. Erfolgreiche Projekte werden voraussichtlich über einen Zeitraum von zehn Jahren eine erhebliche CO₂-Reduktion erzielen und als wegweisend gelten, der in ganz Europa repliziert werden kann.
- Skala: Der Innovationsfonds führt von 2020 bis 2030 jährliche Ausschreibungen durch, die durch die Versteigerung von EU-EHS-Zertifikaten finanziert werden. Jede Ausschreibung stellt Milliarden von Euro zur Verfügung. Die Ausschreibung 2024/25 (für den Zyklus 2025) beispielsweise bietet Zuschüsse in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro – 2,4 Milliarden Euro für eine umfassende Ausschreibung zu Netto-Null-Technologien und 1 Milliarde Euro für eine spezielle Ausschreibung zur Batterieherstellung. Darüber hinaus hat der Fonds wettbewerbliche Wasserstoffauktionen (im Rahmen der Europäischen Wasserstoffbank) eingeführt, um die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zu unterstützen. Das Ausmaß der Förderung ist enorm: Bei einer kürzlich durchgeführten Ausschreibung für 2023 wurden 77 Projekte in 18 Ländern mit 4,2 Milliarden Euro gefördert, wobei für Vorzeigeprojekte Einzelzuschüsse von bis zu 262 Millionen Euro gewährt wurden. Diese Größenordnung macht den Innovationsfonds zu einer äußerst attraktiven Gelegenheit für Unternehmen mit mutigen Klimainnovationsprojekten.
Wer kann sich bewerben und welche Projekte sind förderfähig?
- Berechtigte Antragsteller: Grundsätzlich kann jede juristische Person – ob Privatunternehmen, öffentliche Einrichtung oder Konsortium, ob klein oder groß – Unterstützung aus dem Innovationsfonds beantragen, sofern sie in einem förderfähigen Land registriert ist. Zu den förderfähigen Ländern zählen alle EU-Mitgliedstaaten sowie die am EU-EHS teilnehmenden Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit Norwegen, Island und Liechtenstein). Antragsteller können sich einzeln (als einzelnes Unternehmen oder Organisation) oder als Konsortium mehrerer Partner bewerben. Im Gegensatz zu einigen EU-Programmen ist ein Konsortium nicht zwingend erforderlich; ein einzelnes Unternehmen kann einen Antrag auch allein einreichen. Alle Projekte müssen jedoch in den förderfähigen Ländern durchgeführt werden (d. h. der Projektstandort und die Projektwirkung müssen innerhalb der EU/des EWR liegen).
- Förderfähige Projekte: Der Innovationsfonds fördert eine breite Palette von Projekttypen, die jedoch alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: innovative Technologien mit erheblichen Klimaauswirkungen, die für die Skalierung bereit sind. Zu den wichtigsten Merkmalen förderfähiger Projekte gehören:
- Klimaauswirkungen: Das Projekt sollte die Treibhausgasemissionen in einem der förderfähigen Sektoren deutlich reduzieren. Zu diesen Sektoren gehören erneuerbare Energien (z. B. Solar- und Windenergie der nächsten Generation, erneuerbarer Wasserstoff), Energiespeicherung, energieintensive Industrien (z. B. kohlenstoffarme Stahl-, Zement- und Chemieprozesse), Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, alternative Kraftstoffe, Netto-Null-Mobilität und sogar klimafreundliche Gebäudetechnologien. Die erwartete Vermeidung von CO₂-Emissionen (oder Äquivalenten) über 10 Jahre ist ein entscheidender Faktor – Projekte müssen quantifizieren, wie viele Emissionen sie im Vergleich zu konventionellen Technologien vermeiden werden.
- Innovative Technologie: Projekte müssen einen hohen Innovationsgrad aufweisen. Typischerweise handelt es sich dabei um eine neuartige oder neue Technologie im industriellen Maßstab, die noch nicht kommerziell verfügbar ist. In Bezug auf den Technologiereifegrad (TRL) strebt der Innovationsfonds in der Regel einen Technologiereifegrad von etwa TRL 8 an – d. h. eine Technologie, die sich im Pilotmaßstab bewährt hat und nun erstmals kommerziell demonstriert wird. Reine Forschungs- oder Laborprojekte (TRL 6–7 oder darunter) werden nicht gefördert. Stattdessen sollte das Projekt kurz vor der Kommerzialisierung stehen und eine bahnbrechende Lösung in einer realen Betriebsumgebung demonstrieren. Dieser Fokus stellt sicher, dass der Fonds innovative Projekte unterstützt, die neue Technologien einsetzen, und nicht Forschungsprojekte oder bereits vollständig kommerzielle Lösungen.
- Reife und Lebensfähigkeit: Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Planung, Geschäftsmodell und Finanzstruktur ausreichend ausgereift sind. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung über ein gut entwickeltes Projekt verfügen sollten: Machbarkeitsstudien, ein Businessplan, technische Pläne und idealerweise wichtige Genehmigungen in Bearbeitung. Die EU erwartet von einem Innovationsfondsprojekt Investitionsreife – also eine Vorlage, die Sie Investoren oder dem Vorstand Ihres Unternehmens zur endgültigen Investitionsentscheidung vorlegen können. Ideen im Frühstadium ohne konkrete Umsetzungspläne werden voraussichtlich abgelehnt. Darüber hinaus darf die Projektumsetzung vor Antragstellung noch nicht begonnen haben – d. h. der Bau darf noch nicht im Gange sein und es dürfen noch keine unwiderruflichen Verträge unterzeichnet sein. (Vorbereitende Schritte wie die Sicherung von Grundstücken oder vorläufige Genehmigungen sind ausreichend.)
- Projektgröße: Der Fonds fördert sowohl große als auch kleine Projekte, die jedoch möglicherweise über unterschiedliche Ausschreibungen oder Förderprogramme bearbeitet werden. Historisch wurden „große“ Projekte als Projekte mit Investitionsausgaben über 7,5 Millionen Euro und „kleine“ Projekte als Projekte unter 7,5 Millionen Euro definiert. In jüngsten Ausschreibungen hat die Kommission die Projektgrößen weiter geschichtet – beispielsweise wurde die Ausschreibung 2024/25 so strukturiert, dass große Projekte (CAPEX über 100 Millionen Euro), mittlere Projekte (20–100 Millionen Euro) und kleine Projekte (2,5–20 Millionen Euro) in separaten Kategorien berücksichtigt wurden. Auch Pilotprojekte (hochinnovativ, aber noch nicht im richtigen Maßstab erprobt) erhalten einen besonderen Schwerpunkt. Dies bedeutet, dass Projekte unterschiedlicher Größenordnungen miteinander konkurrieren können – ob Sie eine Pilotanlage für 10 Millionen Euro oder eine kommerzielle Anlage für 200 Millionen Euro planen, es gibt einen Bewerbungsweg. Bedenken Sie jedoch: Je größer die Klimaauswirkungen (und der Finanzierungsbedarf), desto härter die Konkurrenz.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass förderfähige Projekte solche sind, die eine überzeugende, innovative Lösung zur Emissionsreduzierung in Europa darstellen, mit einem gut ausgearbeiteten Plan ausgestattet sind und in einem förderfähigen Land angesiedelt sind. Wenn Ihr Projekt diese Kriterien erfüllt, können Sie einen Antrag auf Förderung des Innovationsfonds stellen.
So bewerben Sie sich: Der Antragsprozess für den Innovationsfonds
- Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen: Um Fördermittel zu beantragen, müssen Projektträger eine offene Ausschreibung des Innovationsfonds beantragen. Ausschreibungen werden in der Regel jährlich (meist im Spätherbst oder Winter) auf der Website der Europäischen Kommission und dem EU-Portal „Funding & Tenders“ veröffentlicht. Die Ausschreibung für den Zyklus 2025 wurde beispielsweise am 3. Dezember 2024 eröffnet. Alle Bewerbungsunterlagen werden elektronisch über das EU-Portal „Funding & Tenders“ eingereicht – eine Einreichung per Post oder E-Mail ist nicht möglich. Potenzielle Antragsteller sollten zunächst ein EU-Login-Konto erstellen und ihre Organisation im Portal registrieren (falls noch nicht geschehen), um auf die Bewerbungsformulare zugreifen zu können.
- Einstufige Anwendung: Derzeit verwendet der Innovationsfonds für seine Hauptausschreibungen ein einstufiges Antragsverfahren. Dies bedeutet, dass Antragsteller in einem Rutsch einen vollständigen Projektvorschlag vorbereiten müssen (im Gegensatz zu einigen EU-Programmen, bei denen zunächst ein Konzeptpapier erstellt wird). Unterschätzen Sie den Aufwand nicht – ein vollständiger Antrag für den Innovationsfonds kann einschließlich technischer Anhänge 200 bis 300 Seiten umfassen. Sie müssen detaillierte Antragsformulare ausfüllen und zahlreiche Dokumente hochladen: eine Projektbeschreibung, einen Geschäftsplan, ein Finanzmodell, einen Umsetzungsplan, Berechnungen der Treibhausgasemissionen (THG) und mehr. Der Antrag erfordert eine gründliche Analyse – Sie müssen beispielsweise die Basis- und die prognostizierten Emissionen berechnen (mithilfe der von der EU bereitgestellten Methoden), eine Kostenanalyse durchführen und oft eine Lebenszyklusanalyse erstellen. Die Vorbereitung dieser Materialien kann mehrere Monate Arbeit eines multidisziplinären Teams in Anspruch nehmen. Es ist daher entscheidend, frühzeitig zu beginnen.
- Auswertung: Nach Ablauf der Einreichungsfrist werden alle Vorschläge einer gründlichen Prüfung ihrer Förderfähigkeit unterzogen und anschließend von unabhängigen, von der Europäischen Kommission ernannten Experten bewertet. Jeder förderfähige Vorschlag wird anhand von fünf zentralen Vergabekriterien bewertet:
- Vermeidung von Treibhausgasemissionen – Wie viele Emissionen werden durch das Projekt vermieden oder reduziert? (Je höher und kostengünstiger die Einsparungen, desto besser.)
- Innovationsgrad – Wie neuartig und bahnbrechend ist die Technologie im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik?
- Projektreife – Wie weit ist das Projekt hinsichtlich Planung, Genehmigung, Finanzierung und Umsetzungsbereitschaft fortgeschritten?
- Skalierbarkeit/Replizierbarkeit – Kann die Lösung skaliert oder anderswo repliziert werden, um die Wirkung in der gesamten EU zu maximieren?
- Kosteneffizienz – Wie kosteneffizient ist das Projekt, gemessen als Höhe der beantragten Finanzierung pro vermiedener Tonne CO₂-Äquivalent? Projekte erhalten in jeder Kategorie Punkte. Nur Projekte, die die Mindestschwellenwerte in allen Kriterien erfüllen, werden für eine Förderung berücksichtigt. Anschließend werden die Vorschläge mit der höchsten Punktzahl ausgewählt, bis das Budget der Ausschreibung ausgeschöpft ist. Die Auswahl erfolgt technologie- und geografieneutral: Es gibt keine festgelegten Quoten nach Sektor oder Land – die Qualität eines Vorschlags wird ausschließlich anhand dieser Kriterien beurteilt. Das sorgt für einen intensiven Wettbewerb. (Beispielsweise gingen für die Ausschreibung 2023 337 Bewerbungen aus ganz Europa ein, von denen nur 85 Projekte für eine Förderung vorselektiert wurden.) Nach der Auswertung wird typischerweise eine Rangliste der Gewinnerprojekte bekannt gegeben (normalerweise gegen Ende des Jahres). Projekte, die hoch bewertet, aber (aufgrund von Budgetbeschränkungen) nicht gefördert wurden, können auf eine Reserveliste gesetzt werden – manchmal, wenn andere ihre Bewerbung zurückziehen, bekommen Reserveprojekte eine Chance, wie es 2024 der Fall war. Alle Bewerber erhalten eine Rückmeldung. Qualitativ hochwertige Vorschläge, die keine Finanzierung erhalten haben, erhalten als Anerkennung zudem ein „Seal of Excellence“ (STEP), das bei der Suche nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten hilfreich sein kann.
- Zeitleiste von der Bewerbung bis zur Bewilligung: Der Prozess von der Einreichung bis zum Erhalt der Mittel ist langwierig. Für die Ausschreibung 2025 beispielsweise war der Stichtag der 24. April 2025. Ergebnisse werden bis zum vierten Quartal 2025 erwartet, die Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarungen bis zum ersten Quartal 2026. Mit anderen Worten vergehen zwischen der Frist und der Finanzhilfevereinbarung etwa 8–10 Monate. Insgesamt kann von dem Zeitpunkt, an dem Sie mit der Vorbereitung Ihres Antrags beginnen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr gefördertes Projekt tatsächlich starten können, weit über ein Jahr vergehen. Laut der EU liegen die Evaluierungsergebnisse für Einreichungen im Frühjahr im Spätherbst vor. Im Falle einer Auswahl unterzeichnen Sie einige Monate später eine Finanzhilfevereinbarung. Projekte haben dann bis zu vier Jahre Zeit, um die Finanzierung abzuschließen und mit der Umsetzung zu beginnen. Antragsteller sollten daher eine lange Vorlaufzeit einplanen und sicherstellen, dass der Zeitplan ihres Projekts dies berücksichtigt.
- Bewerbungstipps: Lesen Sie die offiziellen Ausschreibungsunterlagen und Hinweise auf dem Funding & Tenders-Portal sorgfältig durch. Die Europäische Kommission stellt in der Regel detaillierte Anleitungen, Vorlagen und sogar Webinare oder Infotage für Antragsteller bereit (beispielsweise fand im Dezember 2024 ein Infotag für die IF24-Ausschreibung statt). Nutzen Sie die Fragen-und-Antwort-Runde, falls Unklarheiten bestehen. Und wichtig: Reichen Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig ein – das Portal schließt pünktlich zum Stichtag (in der Regel um 17:00 Uhr MEZ am Stichtag), und verspätete Einreichungen werden nicht akzeptiert. Es ist ratsam, Ihre Dateien einige Tage früher hochzuladen, um technische Probleme in letzter Minute zu vermeiden.
Zusammenarbeit mit einem Berater oder Autor für Innovationsfonds
Die Vorbereitung eines erfolgreichen Antrags auf einen Innovationsfonds ist eine komplexe und ressourcenintensive Aufgabe. Viele Unternehmen engagieren einen Berater oder Antragsschreiber für Innovationsfonds, um ihre Erfolgschancen zu verbessern. Sollten Sie die Beauftragung eines solchen Beraters in Erwägung ziehen? So kann ein kompetenter Berater oder Antragsschreiber einen Mehrwert schaffen:
- Strategische Beratung und Machbarkeitsprüfung: Erfahrene Berater für Innovationsfonds prüfen zunächst, ob Ihr Projekt zu den Zielen und Kriterien des Fonds passt. Sie führen häufig eine Machbarkeitsprüfung oder Projektbewertung durch, um die Stärken und Schwächen des Projekts im Vergleich zur Konkurrenz zu beurteilen. Befindet sich Ihr Projektkonzept noch in einem frühen Stadium oder fehlen wichtige Elemente, kann ein Berater Ihnen raten, ob Sie es jetzt umsetzen oder es gegebenenfalls überarbeiten und sich bei einer späteren Ausschreibung bewerben sollten (eine Go/No-Go-Empfehlung). So sparen Sie sich den Aufwand für einen Antrag, der noch nicht fertig ist.
- Ausrichtung des Projekts an den Finanzierungskriterien: Ein Berater bringt Fachwissen zu den Bewertungskriterien des Innovationsfonds und den politischen Prioritäten der EU mit. Er kann Ihnen helfen, den Umfang Ihres Projekts so zu gestalten, dass er den Erwartungen der Gutachter entspricht – und dafür sorgen, dass Sie die punktebringenden Aspekte hervorheben. Beispielsweise kann er Sie bei der Berechnung der Treibhausgasemissionsvermeidung mit der richtigen Methodik unterstützen oder Ihnen Möglichkeiten vorschlagen, den Beitrag Ihres Projekts zu den EU-Klimazielen und dem Green Deal hervorzuheben. Er stellt sicher, dass Ihre Projektbeschreibung jedes der fünf Kriterien (Innovation, Wirkung, Reife, Skalierbarkeit, Kosten) überzeugend berücksichtigt.
- Verfassen und Dokumentieren von Vorschlägen: Einen klaren und überzeugenden Antrag zu verfassen, ist eine Kunst. Die Autoren von Innovationsfonds sind darin geübt, komplexe technische Projekte so zu formulieren, dass sie die Gutachter überzeugen. Sie können die Antragsunterlagen federführend verfassen oder Ihre Entwürfe durch umfangreiches Lektorat und Feedback verfeinern. Sie achten auf eine klare Sprache, eine gute Erläuterung der Ziele und Auswirkungen sowie die Bereitstellung aller erforderlichen Details und Anhänge. Ein guter Fördermittelautor hilft Ihnen außerdem, häufige Fehler zu vermeiden – wie etwa Unstimmigkeiten zwischen dem technischen und finanziellen Teil oder fehlende Informationen, die Punkte kosten könnten.
- Projektmanagement der Anwendung: Da ein Antrag auf einen Innovationsfonds aus vielen Teilen besteht (technischer Plan, Finanzmodell, Umweltanalyse usw.), fungieren Berater häufig als Projektmanager für den Antragsprozess. Sie legen Zeitpläne fest, koordinieren die Beiträge verschiedener Abteilungen oder Partner und prüfen, ob alle Formulare korrekt ausgefüllt sind. Sie stellen außerdem sicher, dass die endgültige Einreichung vollständig und fristgerecht erfolgt und laden alles rechtzeitig vor Ablauf der Frist in das Portal hoch.
- Expertise aus vergangenen Erfolgen: Erfahrene Berater für Innovationsfonds haben in der Regel bereits an mehreren Anträgen mitgewirkt und wissen, wie ein erfolgreicher Antrag aussieht. Viele sind Ingenieure oder Finanzexperten, die Ihre Daten validieren oder Ihren Business Case untermauern können. Sie können beispielsweise Ihre Kostenannahmen überprüfen oder Verbesserungen für Ihren Risikominderungsplan vorschlagen. Einige Beratungsunternehmen bieten im Erfolgsfall sogar Unterstützung bei der Verhandlung von Fördervereinbarungen an. Diese umfassende Unterstützung kann von unschätzbarem Wert sein, insbesondere für Erstantragsteller oder kleinere Unternehmen mit begrenzten internen Antragskapazitäten.
Lohnt sich das? Die Beauftragung eines Beraters verursacht zwar zusätzliche Kosten, kann aber die Qualität und Erfolgschancen Ihres Antrags deutlich steigern. Angesichts der Höhe der Fördermittel (möglicherweise mehrere zehn Millionen Euro) zahlt sich die Investition in professionelle Unterstützung oft aus. In früheren Förderrunden des Innovationsfonds standen viele erfolgreiche Projekte in der Verantwortung von erfahrenen Beratern oder Autoren. Beispielsweise haben regionale Agenturen lokalen Unternehmen bei der Finanzierung geholfen – zwei bayerische Cleantech-Projekte erhielten mit Unterstützung Zuschüsse in Höhe von 91 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds. Auch mehrere der 85 für die Ausschreibung 2023 ausgewählten Projekte wurden mithilfe spezialisierter Beratungsunternehmen vorbereitet. Diese Experten können den Prozess effizienter steuern und Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden, die ein ansonsten gutes Projekt gefährden könnten.
Natürlich ist die Beauftragung eines Beraters nicht zwingend erforderlich – viele Organisationen erstellen erfolgreiche Anträge intern, insbesondere wenn sie über starke Teams für die Antragstellung verfügen. Wenn Sie jedoch neu in der EU-Förderung sind oder die internen Ressourcen fehlen, ist die Beauftragung eines Beraters oder Antragsschreibers für Innovationsfonds eine sinnvolle Überlegung. Zumindest sollten Sie Ihren Antrag vor der Einreichung extern prüfen lassen, um objektives Feedback zu erhalten.
- Auswahl eines Beraters: Wenn Sie externe Hilfe in Anspruch nehmen, suchen Sie nach Unternehmen oder Einzelpersonen mit Erfahrung im Innovationsfonds oder ähnlichen EU-Klima-/Innovationsprogrammen. Fragen Sie nach deren Erfolgsquote und stellen Sie sicher, dass sie die technischen Aspekte Ihres Projekts verstehen. Klare Vereinbarungen über den Umfang (z. B. Schreiben vs. Beraten) und Vertraulichkeit sind wichtig. Letztendlich liegt der Vorschlag bei Ihnen – ein Berater kann jedoch ein wertvoller Partner bei der Gestaltung und Kommunikation Ihrer Vision sein.
Wichtige Fristen und Ausschreibungen für den Innovationsfonds für 2025 und 2026
Bei der Planung Ihres Innovationsfondsantrags ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Termine und Fristen für die Ausschreibung 2025 sowie die Erwartungen für 2026:
- Ausschreibung 2025 (IF24): Die Hauptausschreibung des Innovationsfonds für den sogenannten Zyklus 2025 begann am 3. Dezember 2024, und die Frist zur Einreichung von Anträgen war der 24. April 2025. Diese oft als IF24 bezeichnete Ausschreibung umfasst eigentlich mehrere Bereiche: eine allgemeine Ausschreibung für Netto-Null-Technologien (Budget 2,4 Milliarden Euro) und eine Ausschreibung für die Batterieherstellung (1 Milliarde Euro), die gleichzeitig starteten. Beide hatten dieselbe Frist, den 24. April 2025. Parallel dazu wurde am 3. Dezember 2024 die zweite Wasserstoffauktion (für grüne Wasserstoffprojekte im Rahmen der Europäischen Wasserstoffbank) mit einer Einreichungsfrist am 20. Februar 2025 gestartet. Potenzielle Antragsteller mussten ihre vollständigen Anträge bis zu diesen Terminen über das EU-Portal einreichen. Nach der Einreichung werden die Bewertungsergebnisse Ende 2025 erwartet (die Kommission hat das vierte Quartal 2025 angegeben) und die Zuschussvergabe sollte bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass erfolgreiche Projekte aus der Ausschreibung 2025 wahrscheinlich Anfang 2026 starten können.
- 2026 Call (voraussichtlich IF25): Die Europäische Kommission startet üblicherweise jedes Jahr im Dezember eine neue Ausschreibung für den Innovationsfonds. Diesem Muster folgend wird die Ausschreibung für die Finanzierung 2026 voraussichtlich im Dezember 2025 veröffentlicht. Offizielle Details werden zwar Ende 2025 bekannt gegeben, Antragsteller können jedoch mit einer ähnlichen Struktur rechnen – möglicherweise einer großen allgemeinen Ausschreibung (möglicherweise mit Schwerpunkt auf vorrangigen Bereichen, die mit der EU-Klimapolitik im Einklang stehen) und vielleicht spezialisierten Ausschreibungen oder Auktionen (z. B. Wasserstoff), während die Kommission ihre Finanzierungsstrategie fortsetzt. Die Einreichungsfrist ist voraussichtlich im Frühjahr 2026, möglicherweise um April 2026 (indikativ). Wenn die Ausschreibung beispielsweise Mitte Dezember 2025 beginnt, könnte die Frist nach einem etwa viermonatigen Bewerbungszeitraum im April 2026 liegen. Das genaue Datum finden Sie immer in der offiziellen Bekanntmachung – es wird auf der EU-Website für Klimaschutz und dem Portal „Finanzierung und Ausschreibungen“ veröffentlicht. Zum jetzigen Zeitpunkt (Mai 2025) erwarten wir, dass der Zeitplan für die Ausschreibung 2026 dem der vorherigen Runden entspricht: Start im Dezember 2025, Frist etwa im April 2026, Ergebnisse bis Ende 2026 und unterzeichnete Zuschüsse bis Anfang 2027.
- Zukünftige Ausschreibungen: Der Innovationsfonds wird über 2026 hinaus mit jährlichen Ausschreibungen bis 2030 fortgeführt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von ETS-Einnahmen. Die jährliche Ausschreibung kann unterschiedliche Schwerpunkte oder spezielle Budgets haben (die Kommission hat die Ausschreibungen an Initiativen wie den Net-Zero Industry Act und REPowerEU angepasst). Sollte Ihr Projekt also nicht rechtzeitig für 2025 oder 2026 fertig sein, können Sie sich auf spätere Ausschreibungen bewerben. Beachten Sie jedoch, dass der Wettbewerb mit der zunehmenden Popularität des Fonds zunimmt. Es ist wichtig, sich über die neuesten Themen und Anforderungen der Ausschreibungen auf dem Laufenden zu halten (melden Sie sich für den EU-Klimaschutz-Newsletter an oder besuchen Sie regelmäßig die Website).
Fristen sind absolut. Verpasst man eine Frist, muss man auf die nächste Ausschreibung warten (in der Regel ein Jahr später). Sobald die Ausschreibungstermine bekannt gegeben wurden, sollten Sie daher Ihre Antragsvorbereitung rückwärts planen. Viele erfolgreiche Bewerber beginnen bereits Monate vor der Ausschreibung mit der Ausarbeitung ihrer Anträge. Um beispielsweise eine Frist im April einzuhalten, ist es ratsam, spätestens im Herbst des Vorjahres mit den ernsthaften Vorbereitungen zu beginnen. Manche beginnen sogar schon ein Jahr früher mit der Datenerfassung, insbesondere bei komplexen Ingenieurprojekten.
Behalten Sie auch nach Ablauf der Bewerbungsfristen die Unterstützungsaktivitäten rund um die Ausschreibungen im Auge. Die Kommission und CINEA (die für die Umsetzung des Fonds zuständige Agentur) veranstalten häufig einige Wochen nach Beginn einer Ausschreibung Infotage, Webinare und Orientierungsgespräche für Antragsteller, bei denen Sie Fragen stellen und Unklarheiten klären können. Diese Veranstaltungen finden typischerweise im Dezember oder Januar statt, wenn die Ausschreibung im Frühjahr endet. Sie werden auf der Website des Innovationsfonds angekündigt und die Teilnahme ist in der Regel kostenlos. Wenn Sie diese Veranstaltungen nutzen, erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Anforderungen der Gutachter und in neue Elemente einer bestimmten Ausschreibung.
Best Practices für einen überzeugenden Innovationsfonds-Vorschlag
Die Beantragung einer Förderung durch den Innovationsfonds ist eine Herausforderung – mit dem richtigen Ansatz können Sie die Erfolgschancen Ihres Antrags jedoch deutlich verbessern. Hier finden Sie einige Best Practices und Erfolgstipps für die Erstellung eines erfolgreichen Innovationsfondsantrags:
- Beginnen Sie früh und planen Sie gründlich: Wie bereits erwähnt, ist die Antragstellung ein umfangreiches Unterfangen (Hunderte von Seiten Dokumentation) und erfordert viel Zeit. Beginnen Sie so früh wie möglich mit der Organisation Ihres Teams und der Aufgaben – idealerweise mindestens sechs Monate vor Ablauf der Frist. Teilen Sie die Arbeit auf: technisches Design, Emissionsberechnungen, Finanzmodellierung, Genehmigungen usw. Erstellen Sie einen Zeitplan mit internen Kontrollpunkten. So vermeiden Sie, dass Sie in letzter Minute ins Schleudern geraten. Tipp: Wenn die Ausschreibung noch nicht eröffnet ist, orientieren Sie sich an den Unterlagen der vorherigen Ausschreibung – die Anforderungen sind oft ähnlich, und Sie können bereits im Voraus einen Entwurf erstellen.
- Verstehen Sie die Bewertungskriterien und passen Sie Ihren Vorschlag entsprechend an: Richten Sie jeden Abschnitt Ihres Vorschlags an den fünf Kriterien (Treibhausgasauswirkungen, Innovation, Reife, Skalierbarkeit, Kosten) aus. Machen Sie es den Gutachtern leicht, Ihre Leistungen in den einzelnen Bereichen zu erkennen. Reservieren Sie beispielsweise einen Abschnitt zur Quantifizierung Ihrer Treibhausgasvermeidung (mit klaren Berechnungen und Verweisen auf die bereitgestellte Methodik) und heben Sie die Zahl hervor (z. B. „Unser Projekt wird bis 2030 jährlich ca. XXX.000 Tonnen CO₂e einsparen“). Betonen Sie die Innovation Ihrer Technologie und wie sie sich vom Stand der Technik unterscheidet – denken Sie daran, dass nur Projekte finanziert werden, die im Vergleich zu aktuellen Lösungen wirklich neuartig sind. Demonstrieren Sie die Projektreife, indem Sie Genehmigungen, Abnahmevereinbarungen oder bestehende Partnerschaften sowie einen soliden Umsetzungsplan auflisten (der zeigt, dass das Projekt grundsätzlich entwicklungsreif ist, sofern die Finanzierung vorliegt). Erörtern Sie Skalierbarkeit/Replizierbarkeit – könnte dies beispielsweise auf zehn weitere Standorte ausgeweitet werden oder den Weg für den Wandel einer ganzen Branche ebnen? Legen Sie, falls verfügbar, Nachweise vor (Bewerbungsschreiben usw.). Achten Sie außerdem auf Kosteneffizienz: Die beantragte Fördersumme sollte durch die Klimaauswirkungen gerechtfertigt sein. Projekte werden in Euro pro vermiedener Tonne CO₂ bewertet. Wenn Ihre Kosten pro Tonne also hoch sind, begründen Sie dies (vielleicht handelt es sich um ein neuartiges Problem, das sich verbessern wird usw.) und zeigen Sie, dass Sie sich der Kosteneffizienz bewusst sind.
- Entwickeln Sie einen soliden Business Case: Behandeln Sie Ihren Innovationsfondsantrag wie einen Investitionsprospekt für ein neues Unternehmen. Die Gutachter möchten sehen, dass das Projekt nicht nur technisch, sondern auch finanziell und betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Fügen Sie einen ausführlichen Geschäftsplan und ein Finanzmodell bei – diese Anhänge sind obligatorisch. Zeigen Sie Ihre geplanten Investitions- und Betriebskosten, Ihre Einnahmen (falls vorhanden) und wie das Projekt langfristig rentabel sein wird. Sollte das Projekt ohne CO2-Bepreisung oder -Unterstützung wirtschaftlich nicht rentabel sein, seien Sie offen, aber erläutern Sie, wie es zum Lernen oder zu zukünftigen Kostensenkungen beiträgt. Heben Sie Kofinanzierungsquellen hervor: Denken Sie daran, dass der Fonds in der Regel bis zu 60% der zusätzlichen Kosten kofinanziert. Sie müssen daher nachweisen, woher die restlichen Investitionen kommen (z. B. Unternehmenskapital, Bankkredite, staatliche Zuschüsse). Eine klare Finanzierungsstrategie und Unterstützungsschreiben von Investoren oder Banken können die Reife und Glaubwürdigkeit Ihres Antrags deutlich stärken. Beschreiben Sie außerdem die Erfahrung Ihres Projektteams – zeigen Sie, dass das Konsortium oder Unternehmen über das Know-how verfügt, dieses Projekt umzusetzen.
- Heben Sie die Klimazusätzlichkeit hervor: Der Innovationsfonds zielt darauf ab, die Klimawirkung zu maximieren. Ihr Antrag sollte klar darlegen, warum das Projekt ohne die Förderung nicht umgesetzt werden könnte (oder deutlich weniger Klimanutzen hätte). Beispielsweise könnte die Technologie hohe Vorlaufkosten oder Risiken mit sich bringen, die der Markt derzeit nicht finanzieren kann – daher ist öffentliche Förderung erforderlich. Mit dieser Begründung sprechen Sie die grundlegende Mission des Fonds an. Verwenden Sie Daten: z. B.: „Ohne Förderung würde unser innovatives Zementwerk 201 t CO₂ einsparen; mit der Förderung des Innovationsfonds können wir eine Reduzierung von 901 t CO₂ erreichen und so zusätzlich 500.000 t CO₂ pro Jahr einsparen, die sonst weiterhin ausgestoßen würden.“
- Stellen Sie technische Solidität und Details sicher: Obwohl der Vorschlag keine wissenschaftliche Arbeit ist, muss er Experten von der wissenschaftlichen und technischen Glaubwürdigkeit Ihrer Technologie überzeugen. Geben Sie ausreichend Details zur Technologie (Design, Prozessablauf usw.) an, um zu zeigen, dass Sie sie beherrschen. Fügen Sie Ergebnisse aus Pilotversuchen oder Simulationen hinzu, um Ihre Leistungsaussagen zu untermauern. Wenn Sie ein neuartiges Verfahren verwenden, erwähnen Sie Patente, Veröffentlichungen oder Expertenempfehlungen. Halten Sie die Erklärungen gleichzeitig verständlich – Gutachter sind möglicherweise keine Spezialisten in Ihrer Nische. Erläutern Sie daher alle Fachbegriffe und Konzepte. Verwenden Sie Diagramme oder Tabellen (Anhänge sind in der Bewerbung zulässig), um das Projektdesign und die Zeitpläne zu veranschaulichen – ein Bild kann einen komplexen Prozess viel schneller vermitteln als Text.
- Quantifizieren Sie alles, was Sie können: Legen Sie nach Möglichkeit quantitative Belege vor. Ziele, Kennzahlen und Zahlen machen Ihren Vorschlag überzeugender. Verwenden Sie für Emissionen die offizielle Berechnungsmethode und geben Sie die gesamten vermiedenen Treibhausgasemissionen über 10 Jahre klar an. Quantifizieren Sie im Hinblick auf Innovationen beispielsweise Effizienzgewinne (z. B. „50% weniger Energieverbrauch als der Stand der Technik“) oder andere Leistungsverbesserungen. Beschreiben Sie im Hinblick auf Skalierbarkeit ein mögliches Replikationsszenario (z. B. „Bei Anwendung auf alle Stahlwerke in Europa könnte diese Technologie jährlich X Millionen Tonnen CO₂ einsparen“). Konkrete Zahlen bleiben den Gutachtern im Gedächtnis und verleihen Glaubwürdigkeit (achten Sie jedoch darauf, dass sie realistisch sind und über Belege verfügen).
- Seien Sie klar und präzise: Ein klarer und verständlicher Text ist entscheidend. Gutachter müssen Hunderte von Seiten lesen. Erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie strukturiert und prägnant schreiben. Verwenden Sie Überschriften und Unterüberschriften, die den Bewertungskriterien oder der im Antragsformular geforderten Struktur entsprechen. Fassen Sie wichtige Informationen in Aufzählungspunkten oder Tabellen zusammen (z. B. eine Tabelle mit Treibhausgasberechnungen oder eine Zeitleiste mit Meilensteinen). Vermeiden Sie unnötigen Fachjargon und geben Sie bei Bedarf eine kurze Erklärung ab. Denken Sie daran: Ihr Vorschlag ist im Wesentlichen ein Pitch – er sollte eine überzeugende Geschichte von Innovation und Wirkung erzählen und mit Belegen untermauern. Viele Unternehmen beauftragen einen Autor des Innovationsfonds oder lassen den Text zumindest von mehreren Gutachtern auf Kohärenz und Grammatik überprüfen. Schlechter Schreibstil kann großartige Ideen verschleiern. Planen Sie daher Zeit für Korrekturlesen und die Verfeinerung des Textes ein.
- Sprechen Sie potenzielle Risiken offen an: Jedes innovative Projekt birgt Risiken – technische Ausfälle, Kostenüberschreitungen, regulatorische Hürden usw. In der Bewerbung wird üblicherweise eine Risikobewertung verlangt. Scheuen Sie sich nicht davor, sondern legen Sie stattdessen einen durchdachten Plan zur Risikominderung vor. Die Identifizierung von Risiken und die Bereitstellung von Lösungen (Notfallpläne, zusätzlicher Supportbedarf, schrittweises Vorgehen usw.) zeigen den Gutachtern, dass Sie realistisch und vorbereitet sind, und unterstreichen so die Projektreife.
- Verwenden Sie die bereitgestellten Ressourcen und Vorlagen: Die Europäische Kommission stellt Leitfäden, FAQs und Vorlagen zur Verfügung – um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Nutzen Sie die offizielle Antragsvorlage als Gliederung und füllen Sie alle Abschnitte aus. In den FAQ oder im Helpdesk der Kommission finden Sie weitere Informationen zum Umfang oder den Regeln (z. B. zur Förderfähigkeit bestimmter Kosten). Darüber hinaus können die Beschreibungen früherer Projekte des Innovationsfonds (verfügbar auf der offiziellen Website) Aufschluss darüber geben, wie erfolgreiche Projekte aussehen. Zusammenfassungen geförderter Projekte sind hilfreich, um deren Innovationsgrad und Wirkung einzuschätzen.
- Erwägen Sie eine externe Überprüfung oder Unterstützung: Vor der Einreichung ist es äußerst hilfreich, Ihren Vorschlag von jemandem, der nicht direkt am Schreiben beteiligt ist, kritisch prüfen zu lassen. Dies könnte ein interner Kollege aus einem anderen Team oder ein externer Berater sein, falls Sie einen beauftragt haben. Diese könnten Auslassungen oder Unklarheiten entdecken. Führen Sie nach Möglichkeit eine Probebewertung durch – bewerten Sie Ihren Vorschlag ehrlich anhand der fünf Kriterien, um mögliche Schwächen zu erkennen und diese dann zu verbessern. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, kann ein Berater oder Autor des Innovation Funds kompetentes Feedback geben und sicherstellen, dass Ihr Vorschlag auf hohem Niveau ausgearbeitet ist, was Ihre Erfolgschancen erhöht.
Bis 2025 hat der Innovationsfonds bereits Dutzende innovativer Projekte finanziert (77 Projekte erhielten Fördermittel im Rahmen der Ausschreibung 2023, plus sechs weitere aus der Reserveliste). Dies zeigt, dass ambitionierte Anträge erfolgreich sein können. Lernen aus vergangenen Erfolgen kann Ihre eigene Antragsstrategie beeinflussen. Die Einhaltung dieser Best Practices wird dazu beitragen, dass Ihr Antrag für den Innovationsfonds im wettbewerblichen Bewertungsprozess hervorsticht. Ein überzeugender, gut vorbereiteter Antrag erzielt nicht nur bessere Ergebnisse, sondern stärkt auch das Vertrauen der Gutachter in die Fähigkeit Ihres Teams, das Projekt in der Praxis umzusetzen – ein entscheidender Aspekt für diesen Fonds.
Fazit: Vorbereitung auf den Erfolg des Innovationsfonds
Der EU-Innovationsfonds bietet Innovatoren im Bereich sauberer Technologien und Klimalösungen ab 2025, 2026 und darüber hinaus eine hervorragende Chance. Seine umfangreiche Finanzierung kann ehrgeizige Projekte verwirklichen und sowohl Ihr Unternehmenswachstum als auch Europas Weg zu Netto-Null-Emissionen beschleunigen. Um vom Innovationsfonds erfolgreich zu sein, müssen Sie proaktiv sein: Planen Sie vorausschauend, erstellen Sie einen überzeugenden Antrag und nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen – einschließlich der Möglichkeit, einen Berater oder Experten des Innovationsfonds hinzuzuziehen, um Ihren Antrag zu stärken.
Beachten Sie die wichtigsten Fristen (April 2025 und voraussichtlich Frühjahr 2026 für die kommenden Ausschreibungen) und verfolgen Sie die offiziellen EU-Kanäle hinsichtlich Aktualisierungen oder neuer Möglichkeiten. Der Prozess ist anspruchsvoll, aber die Belohnung ist hoch – nicht nur in Form von Finanzierung, sondern auch in Form von Prestige und Dynamik. Vom Innovationsfonds ausgewählte Projekte gelten als Vorreiter und ziehen oft zusätzliche Investoren, Partner und öffentliche Aufmerksamkeit an.
Kurz gesagt: Machen Sie Ihre Hausaufgaben, erzählen Sie eine überzeugende Geschichte mit soliden Daten und reichen Sie Ihre Bewerbung rechtzeitig ein. Viele Organisationen haben diesen Weg bereits beschritten und sich Fördermittel in Millionenhöhe gesichert, um ihre Träume von Klimainnovationen zu verwirklichen – mit sorgfältiger Vorbereitung könnte Ihr Projekt das nächste sein. Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung für den Innovationsfonds und auf Ihren potenziellen Erfolg in den Förderphasen 2025 und 2026!
Das Antragsformular für den EU-Innovationsfonds verstehen
Der Innovationsfonds der Europäischen Union (INNOVFUND) unterstützt innovative Projekte mit Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen Technologien. Die Beantragung dieser Förderung erfordert ein spezielles Antragsverfahren, das hauptsächlich über das EU-Förder- und Ausschreibungsportal läuft. Kernstück dieses Verfahrens ist das Antragsformular, ein umfassendes Dokument, das alle notwendigen administrativen und technischen Details eines vorgeschlagenen Projekts erfasst. Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick basierend auf der bereitgestellten Version 4.0 (Stand: 15. November 2024) der Standardvorlage für das INNOVFUND-Antragsformular. Wichtig zu beachten: Dieses Dokument dient als Beispiel und die tatsächlich auf dem Portal verfügbaren Formulare können abweichen.
Aufbau des Antragsformulars
Das Antragsformular gliedert sich in zwei Hauptteile:
- Teil A: Verwaltungsformulare: Dieser Abschnitt enthält strukturierte Verwaltungsinformationen zum Projekt und seinen Teilnehmern. Er wird automatisch vom IT-System auf Grundlage der vom Antragsteller direkt in die Formulare des Portal-Einreichungssystems eingegebenen Daten generiert.
- Teil B: Technische Beschreibung: Hierbei handelt es sich um eine narrative Beschreibung der technischen Aspekte des Projekts. Antragsteller müssen die Vorlage vom Portal herunterladen, ausfüllen und zusammen mit den erforderlichen Anhängen als PDF-Datei hochladen.
Teil A: Verwaltungsformulare – Wichtige Abschnitte
Teil A muss direkt online über das Portal ausgefüllt werden. Das bereitgestellte Dokument dient als Beispiel und muss nicht ausgefüllt werden. Es beschreibt die typischen Abschnitte:
- Allgemeine Informationen: Enthält die Ausschreibungskennung, das Thema, die Art der Maßnahme, Details zum Vorschlag (Akronym, Titel, Dauer), eine Zusammenfassung, Schlüsselwörter und Informationen zu früheren Einreichungen. Der Vorschlagstitel sollte auch für Laien verständlich sein.
- Teilnehmer: Listet alle am Projekt beteiligten Organisationen auf. Detaillierte Informationen zu jedem Teilnehmer sind erforderlich, einschließlich Name, Anschrift, Rechtsform (öffentliche Einrichtung, gemeinnützig, KMU-Status usw.) und Abteilungsdetails.
- Budget: Eine Übersicht über die beantragte Zuschusshöhe pro Begünstigtem.
- Andere Fragen: Dieser Abschnitt kann Einzelheiten zu den Standorten der Projektimplementierung und spezifische Berechnungen im Zusammenhang mit den Projektzielen enthalten, wie etwa die Vermeidung von Treibhausgasemissionen (THG) (absolut und relativ) und die Kosteneffizienz.
- Erklärungen: Der Antragsteller muss mehrere Erklärungen abgeben, in denen er bestätigt:
- Zustimmung aller Teilnehmer.
- Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
- Erfüllung der Förderkriterien, Fehlen von Ausschlussgründen und finanzielle/operative Leistungsfähigkeit.
- Bestätigung der Kommunikation über das Portal und Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung.
- Bei Pauschalzuschüssen ist zu bestätigen, dass das Budget den üblichen Kostenrechnungspraktiken entspricht und nicht förderfähige Kosten ausschließt.
- Verstehen Sie, dass falsche Angaben zu Verwaltungsstrafen führen können.
- Der Koordinator ist für seine Angaben verantwortlich, jeder Antragsteller für seine eigenen. Bei Förderung ist eine ehrenwörtliche Erklärung erforderlich.
Das System umfasst Validierungsprüfungen und zeigt Fehler (die die Übermittlung blockieren) oder Warnungen (die die Übermittlung nicht blockieren, sondern auf fehlende/falsche Werte hinweisen) an.
Teil B: Technische Beschreibung – Kernkomponenten
Teil B erfordert eine ausführliche Beschreibung und muss bestimmte Formatierungsregeln (z. B. Seitenbegrenzung, Schriftgröße, Ränder) einhalten. Bei Überschreitung der Seitenbegrenzung (in der Regel 70 Seiten, sofern nicht anders angegeben) werden die überzähligen Seiten nicht berücksichtigt. Für wichtige Informationen sollten keine Hyperlinks verwendet werden.
Zu den wichtigsten Abschnitten in Teil B gehören:
- Projekt und Antragsteller (Abschnitt 0): Bietet Hintergrundinformationen, Begründungen, Ziele, stellt die Konsortiumsmitglieder vor und skizziert die technischen Merkmale des Projekts (Standort, Technologie, Inputs, Outputs). Außerdem werden der Technologieumfang, die Konstruktion, der Betrieb, die Wartungspläne, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und die technische Leistung detailliert beschrieben. Für batteriebezogene Ausschreibungen sind spezifische Angaben zu Chemie und Leistung erforderlich.
- Innovationsgrad (Abschnitt 1): Beschreibt die Innovation des Projekts im Vergleich zum aktuellen kommerziellen und technologischen Stand der Technik, wobei der Schwerpunkt auf europäischen oder relevanten globalen Ebenen liegt. Es muss erläutert werden, wie das Projekt über inkrementelle Innovation hinausgeht. Dabei muss auf Daten aus dem Anhang zur Machbarkeitsstudie verwiesen und die erwartete Steigerung des Reifegrads sowie die zu überwindenden Hindernisse detailliert beschrieben werden.
- Potenzial zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen (Abschnitt 2): Erfordert die Berechnung des absoluten und relativen Treibhausgas-Emissionsvermeidungspotenzials über 10 Jahre nach Inbetriebnahme unter Verwendung der offiziellen Methodik und des Berechnungsmodells. Annahmen für Referenz- und Projektszenarien müssen erläutert werden. Die Ergebnisse müssen mit Teil C und der Kosteneffizienzberechnung übereinstimmen. Bei Projekten im Rahmen des EU-EHS müssen die Emissionen unter dem relevanten Benchmark liegen. Projekte, die Biomasse verwenden, müssen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Bei Batterieprojekten umfasst dieser Abschnitt den CO2-Fußabdruck der Herstellung, der jedoch ebenfalls separat bewertet wird.
- Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Fertigung (Abschnitt 3, n. z. für NZT-Aufruf): Ähnlich wie bei der Vermeidung von Treibhausgasen sind hierfür eine Bewertung und Berechnung unter Verwendung der angegebenen Methodik und Vorlage sowie detaillierte Annahmen erforderlich.
- Projektreife (Abschnitt 4): Bewertet die Projektbereitschaft in technischer, finanzieller und betrieblicher Hinsicht.
- Technische Reife: Nachweis der Technologiebereitschaft, der technischen Machbarkeit, der Risikobewertung und -minderung, unterstützt durch einen obligatorischen Anhang zur Machbarkeitsstudie und möglicherweise Due-Diligence-Berichte.
- Finanzielle Fälligkeit: Der Schwerpunkt liegt auf der Solidität des Geschäftsplans, der Finanzierungsstruktur und den Förderzusagen. Erforderlich sind Anhänge wie ein detaillierter Budget-/Kostenrechner, ein Geschäftsplan, ein Finanzmodell sowie gegebenenfalls Aktionärserklärungen und unterstützende Dokumente. Erforderlich sind Zusammenfassungen des Geschäftsvorschlags, Cashflow-Prognosen, Rentabilität (vor/nach Fördermittelbewilligung), Sensitivitätsanalyse, Finanzierungsplan und Förderzusagen.
- Betriebsreife: Demonstriert einen umfassenden und realistischen Implementierungsplan. Details umfassen den Implementierungszeitplan (Gantt-Diagramm erforderlich), wichtige Meilensteine (Finanzabschluss, Inbetriebnahme), Genehmigungsstrategie, Betriebsstrategie (Wartung, Kapazitäten), Projektmanagementteam (Qualifikationen, Fähigkeiten) und Projektorganisation (Struktur, Governance, Qualitäts-/Sicherheitsprozesse). Informationen zu geistigem Eigentum, Genehmigungen, öffentlicher Akzeptanz und Umweltauswirkungen sind ebenfalls erforderlich. Ein Projektdiagramm, das die Beziehungen der Stakeholder veranschaulicht, wird erwartet.
- Risikomanagement: Beschreibt die kritischen Risiken und die Strategie zu deren Bewältigung unter Bezugnahme auf den Geschäftsplan und die Machbarkeitsstudie.
- Reproduzierbarkeit (Abschnitt 5): Beschreibt das Potenzial des Projekts für eine breitere Anwendung. Dies umfasst die Bewältigung von Ressourcenengpässen (z. B. kritische Rohstoffe, Biomasse) durch Effizienz oder Kreislaufwirtschaft, das Potenzial für positive Umweltauswirkungen über die Treibhausgasreduzierung hinaus (z. B. Biodiversität, Schadstoffreduzierung) und das Potenzial für den Einsatz an anderen Standorten oder in der gesamten Wirtschaft. Die erwartete Emissionsvermeidung durch Replikation muss quantifiziert werden. Es umfasst auch den Beitrag zur industriellen Führungsrolle und Wettbewerbsfähigkeit Europas. Pläne für Wissensaustausch, Kommunikation, Verbreitung und die Sicherstellung der Sichtbarkeit der EU-Förderung werden hier skizziert.
- Versorgungssicherheit und Abhängigkeitsbekämpfung (Abschnitt 6, n. z. B. für NZT-Aufruf): Erläutert den Beitrag des Projekts zur Sicherung von Lieferketten und Reduzierung von Abhängigkeiten gemäß Ausschreibungsdokument.
- Kosteneffizienz (Abschnitt 7): Erfordert eine Berechnung des Kosteneffizienzverhältnisses (Gesamtbetrag der beantragten Förderung + sonstige öffentliche Förderung / absolute Treibhausgasvermeidung über 10 Jahre). Hierzu sind detaillierte Berechnungen der relevanten Kosten unter Verwendung der bereitgestellten Vorlage für die Finanzinformationsdatei einzureichen und die verwendete Methodik (z. B. Standard- oder Referenzanlage) zu erläutern. Der maximale Zuschuss darf 60% der relevanten Kosten nicht überschreiten.
- Bonuspunkte (Abschnitt 8, n. z. B. für BATTERIEN-Anruf): Befasst sich mit etwaigen anwendbaren Bonuspunkten, die im Ausschreibungsdokument erwähnt werden und einer Begründung bedürfen.
- Arbeitsplan, Arbeitspakete, Aktivitäten, Meilensteine, Ergebnisse und Zeitplan (Abschnitt 9): Bietet eine detaillierte Aufschlüsselung des Ausführungsplans des Projekts.
- Arbeitsplanübersicht: Eine Liste oder ein Diagramm aller Arbeitspakete (WPs) mit Dauer, Liefergegenständen und Meilensteinen.
- Arbeitspakete: Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Arbeitspakete. Arbeitspakete sind wichtige Unterteilungen mit Zielen, Aktivitäten, Meilensteinen und Ergebnissen. Zu den obligatorischen sequenziellen Arbeitspaketen gehören: Bis zum Finanzabschluss (Arbeitspaket 1), Zwischen Finanzabschluss und Inbetriebnahme (Arbeitspaket 2) und jährliche Arbeitspakete für die Betriebs-/Berichtsphase (Jahre 1–3 oder 1–X, je nach Ausschreibung). Durch Unterteilung können zusätzliche Arbeitspakete erstellt werden.
- Aktivitäten: Spezifische Aufgaben innerhalb jedes WP, die die Beteiligung der Teilnehmer (Koordinator, Begünstigter usw.) zeigen. WP1 sollte die für den Finanzabschluss erforderlichen Dokumente detailliert aufführen.
- Meilensteine und Ergebnisse: Meilensteine sind wichtige Kontrollpunkte. Zu den obligatorischen Meilensteinen, die Zahlungen auslösen, gehören der Finanzabschluss (Ende von WP1), die Inbetriebnahme (Ende von WP2) und die jährliche Treibhausgasberichterstattung (Ende der operativen WPs). Nachweise für Meilensteine sind erforderlich. Liefergegenstände sind Projektergebnisse, die zum Nachweis des Projektfortschritts eingereicht werden, mit festgelegten Fälligkeitsterminen und Verbreitungsstufen (öffentlich, vertraulich, EU-Verschlusssache). Spezifische obligatorische Liefergegenstände sind im Ausschreibungsdokument aufgeführt.
- Budget und Zeitplan: Verweist auf das detaillierte Budget/den entsprechenden Kostenrechner und erfordert einen beigefügten Zeitplan/ein Gantt-Diagramm.
- Sonstiges (Abschnitt 10): Enthält normalerweise Abschnitte zu Ethik und Sicherheit, die in der Vorlage oft als „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet sind.
- Erklärungen (Abschnitt 11): Beinhaltet Bestätigungen hinsichtlich Patenten, Verbot der Doppelfinanzierung (Bestätigung, dass keine anderen EU-Zuschüsse dieselben Kosten decken), Zustimmung zur Beurteilung einer möglichen Projektentwicklungshilfe (PDA) durch die EIB, Zustimmung zur Berücksichtigung bei nationalen Finanzierungsprogrammen (Weitergabe des Vorschlags an die nationalen Behörden) und Zustimmung zur Weitergabe grundlegender Projektinformationen an die Mitgliedstaaten.
Einreichung und Anlagen
- Der Antrag muss vom Konsortium vorbereitet und von einem Vertreter vor Ablauf der Frist online über das Portal eingereicht werden.
- Zu den obligatorischen Anhängen gehören die detaillierte Budgettabelle/der relevante Kostenrechner (Finanzinformationsdatei) und ein Zeitplan/Gantt-Diagramm. Weitere Anhänge wie die Machbarkeitsstudie, der Geschäftsplan und das Finanzmodell sind als Teil der Abschnitte von Teil B erforderlich.
Diese detaillierte Aufschlüsselung bietet einen umfassenden Überblick über die Anforderungen und den Aufbau des Antragsformulars für den EU-Innovationsfonds basierend auf dem bereitgestellten Musterdokument. Antragsteller sollten stets das spezifische Ausschreibungsdokument und die Live-Formulare im Funding & Tenders Portal konsultieren, um die aktuellsten und genauesten Informationen zu erhalten.
Erstellen eines umfassenden Geschäftsplans für Anträge auf Innovationsfonds
Das bereitgestellte Dokument enthält eine Vorlage für einen detaillierten Geschäftsplan, der im Rahmen eines Antrags beim Innovationsfonds eingereicht werden kann. Die Verwendung dieser Vorlage wird empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Antragsteller müssen jedoch sicherstellen, dass sie einen vergleichbaren Detaillierungsgrad und vergleichbare Informationen für eine gründliche Bewertung bereitstellen. Sollte ein Abschnitt nicht zutreffend sein, ist dies zu kennzeichnen und zu begründen.
Dieser Geschäftsplan dient als wichtiges Instrument zur Bewertung der Realisierbarkeit, der finanziellen Solidität und des Gesamtpotenzials eines geplanten Finanzierungsprojekts. Er erfordert eine eingehende Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Projekts, vom Kernkonzept bis hin zu Risikomanagementstrategien.
- Projektidentifikation
Der Plan beginnt mit der grundlegenden Identifizierung des Projekts, die die klare Angabe des vollständigen Projektnamens und seines Akronyms erfordert.
- Geschäftsvorschlag
Dieser Kernabschnitt erfordert eine klare Formulierung des Business Case des Projekts:
- Produkt- oder Geschäftskonzept: Beschreiben Sie das zugrunde liegende Geschäftsmodell, den einzigartigen Wertbeitrag des Projekts im Vergleich zu bestehenden Lösungen und seine Ausrichtung auf die Gesamtstrategie des Unternehmens.
- Zielmarkt und Marktpotenzial: Geben Sie einen Überblick über den allgemeinen Markt und das spezifische Marktpotenzial, auf das das Projekt abzielt. Dazu gehört eine Darstellung des relevanten regulatorischen Umfelds und eine Erläuterung, wie das Projekt Marktlücken schließt, neue Nachfrage oder Märkte generiert, bestehende erweitert oder den Mehrwert bestehender Produkte/Dienstleistungen steigert.
- Kommerzialisierungsstrategie und Marktakzeptanz: Beschreiben Sie detailliert die erwartete Nachfrage nach den vorgeschlagenen Produkten oder Dienstleistungen, identifizieren Sie wichtige Kundensegmente und diskutieren Sie alle potenziellen Markteintrittsbarrieren.
- Wettbewerbslandschaft: Beschreiben Sie die wichtigsten Wettbewerber und alternativen Lösungen, die derzeit auf dem Markt sind.
- Finanzielle Annahmen
Transparenz und Begründung sind in diesem Abschnitt entscheidend. Antragsteller müssen die Annahmen hinter ihren Finanzprognosen erläutern:
- Abbauen: Geben Sie die erwarteten Einnahmen, Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebsausgaben (OPEX) detailliert an, wie sie in der beigefügten Finanzinformationsdatei und im detaillierten Finanzmodell des Antragstellers verwendet werden. Die Prognosen müssen die gesamte Projektlaufzeit abdecken.
- Eventualitäten: Fügen Sie eine detaillierte Begründung für alle Eventualitäten bei, die auf die CAPEX- und OPEX-Schätzungen angewendet werden.
- Zugrundeliegende Daten: Erläutern Sie Annahmen zu Mengen und Preisen in Bezug auf Abnehmer, Lieferanten und Auftragnehmer. Wichtig ist, dass Sie präzise Verweise auf Belege (wie Machbarkeitsstudien oder Vertragsbedingungen) angeben, die diese Annahmen untermauern. Eine Übersichtstabelle mit den wichtigsten Parametern (Wert, Einheit, Begründung, Dokumentenreferenz) ist erforderlich.
- Projektpartner und Vertragsstrategie
Es ist wichtig, das Ökosystem des Projekts zu verstehen:
- Projektdiagramm: Fügen Sie ein Diagramm bei, das die Beziehungen zwischen allen Projektbeteiligten (Sponsoren, Anteilseigner, Kreditgeber, Abnehmer, Lieferanten, Auftragnehmer, Berater, Versicherer usw.) und dem Projekt selbst veranschaulicht. Falls eine Zweckgesellschaft (SPV) eingesetzt wird, sollte dies angegeben werden. Rechtliche und vertragliche Beziehungen sollten dargelegt werden.
- Beschreibung der Projektpartner: Beschreiben Sie jede Gegenpartei, ihre Rolle, ihren Beitrag und ihre technische, finanzielle und kommerzielle Lage (einschließlich Erfolgsbilanz, wichtiger Finanzdaten und Kreditratings, sofern verfügbar).
- Robustheit und Strategie zur Sicherung von Verträgen: Erläutern Sie die wichtigsten Bedingungen indikativer oder gesicherter Liefer-, Bau- und Abnahmeverträge. Erläutern Sie die Strategie und den aktuellen Stand zur Sicherung aller für die Betriebsphase erforderlichen wichtigen Handelsverträge.
- Detaillierte Cashflow-Prognosen und Projektrentabilität
In diesem Abschnitt geht es um die finanzielle Leistung des Projekts:
- Cashflow-Prognosen: Beschreiben Sie die Cashflow-Prognosen des Projekts, wie sie in den Ausgabeblättern der Finanzinformationsdatei dargestellt sind.
- Erwartete Projektrentabilität: Erläutern Sie die Realisierbarkeit des Projekts anhand von Berechnungen des Nettogegenwartswerts (NPV) und des internen Zinsfußes (IRR) vor und nach der beantragten Förderung durch den Innovationsfonds, geschätzt über die gesamte Projektlaufzeit. Begründen Sie die verwendeten gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) und die Erreichbarkeit des angenommenen Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses.
- Sensitivitätsanalyse
Bewerber müssen beurteilen, wie sich die identifizierten Schlüsselrisiken auf die Rentabilität des Projekts (NPV oder IRR) auswirken, und ein Verständnis für potenzielle finanzielle Schwachstellen nachweisen.
- Finanzierungsplan
Es ist eine klare Darstellung der Finanzierung des Projekts erforderlich:
- Finanzierungsquellen und -verwendung: Beschreiben Sie die Finanzierungsquellen des Projekts (Eigenkapital, Fremdkapital, öffentliche Zuschüsse) und deren Verwendungszweck. Achten Sie dabei auf die Übereinstimmung mit der Übersicht in der Finanzinformationsdatei. Geben Sie für jede Finanzierungsquelle Art, Betrag und Anbieter an.
- Finanzierungsstruktur: Erläutern Sie den Plan zur Kapitaleinlage, Einzelheiten zur Fremdfinanzierung (Unternehmens- oder Projektebene, Rückgriffsebene) und begründen Sie die erwarteten Kreditbedingungen anhand der Projektrisiken und Cashflows. Legen Sie nach Möglichkeit unterstützende Schreiben von Geldgebern vor.
- Zuteilung des Zuschusses aus dem Innovationsfonds: Erläutern Sie, wie sich die Pauschalaufteilung des beantragten Zuschusses proportional zu den Aktivitäten, Arbeitspaketen und Projektmeilensteinen verhält.
- Projektfinanzierer und Investorenengagement
Der Nachweis einer soliden finanziellen Ausstattung ist unerlässlich:
- Beschreibung der Finanzierungsparteien: Beschreiben Sie jeden Finanzierungsgeber, seinen Beitragsbetrag und die finanzielle Lage der Projektbeteiligten (unter Bezugnahme auf die eingereichten Jahresabschlüsse).
- Förderbedingungen und Strategie zur Finanzierungssicherung: Beschreiben Sie detailliert den Status der Sicherung aller Finanzierungsquellen. Beschreiben Sie die Förderbedingungen der einzelnen Geldgeber und die Eigentümerstruktur. Referenzdokumente (MoUs, LoIs, Verpflichtungserklärungen) bestätigen die Glaubwürdigkeit und das Engagement der Geldgeber. Bei Projekten mit geringerer Rentabilität oder höherem Risiko ist ein glaubwürdiger Nachweis der Unterstützung der Aktionäre während des gesamten Projektlebenszyklus, einschließlich der Deckung möglicher Defizite, entscheidend.
- Zeitplan für den Finanzabschluss: Begründen Sie den geplanten Termin für den Finanzabschluss, skizzieren Sie erreichte Meilensteine und ausstehende Aufgaben und zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, die im Ausschreibungsdokument festgelegten Termine einzuhalten.
- Risikoanalyse und -management
Eine gründliche Risikobewertung ist zwingend erforderlich:
- Geschäftsrisiken: Identifizieren und beschreiben Sie die Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsplan, die die Rentabilität beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie dazu das bereitgestellte Tabellenformat (Risikonummer, Art, Beschreibung, Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Eigentumsverhältnisse, Minderungsmaßnahmen).
- Finanzierungsrisiken: Identifizieren und beschreiben Sie auf ähnliche Weise die Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Finanzierungsplan mithilfe eines Tabellenformats und geben Sie auch einen Überblick über etwaige Notfallfinanzierungsquellen.
- Risiko-Heatmap: Fügen Sie eine visuelle Risiko-Heatmap ein, die die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung der wichtigsten identifizierten Risiken zusammenfasst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorlage für den Businessplan des Innovationsfonds eine umfassende, gut dokumentierte und realistische Darstellung des Business Case, der Finanzstruktur und der Risikolandschaft des Projekts erfordert. Für eine erfolgreiche Bewerbung ist es entscheidend, jeden Abschnitt mit dem erforderlichen Detaillierungsgrad zu behandeln.