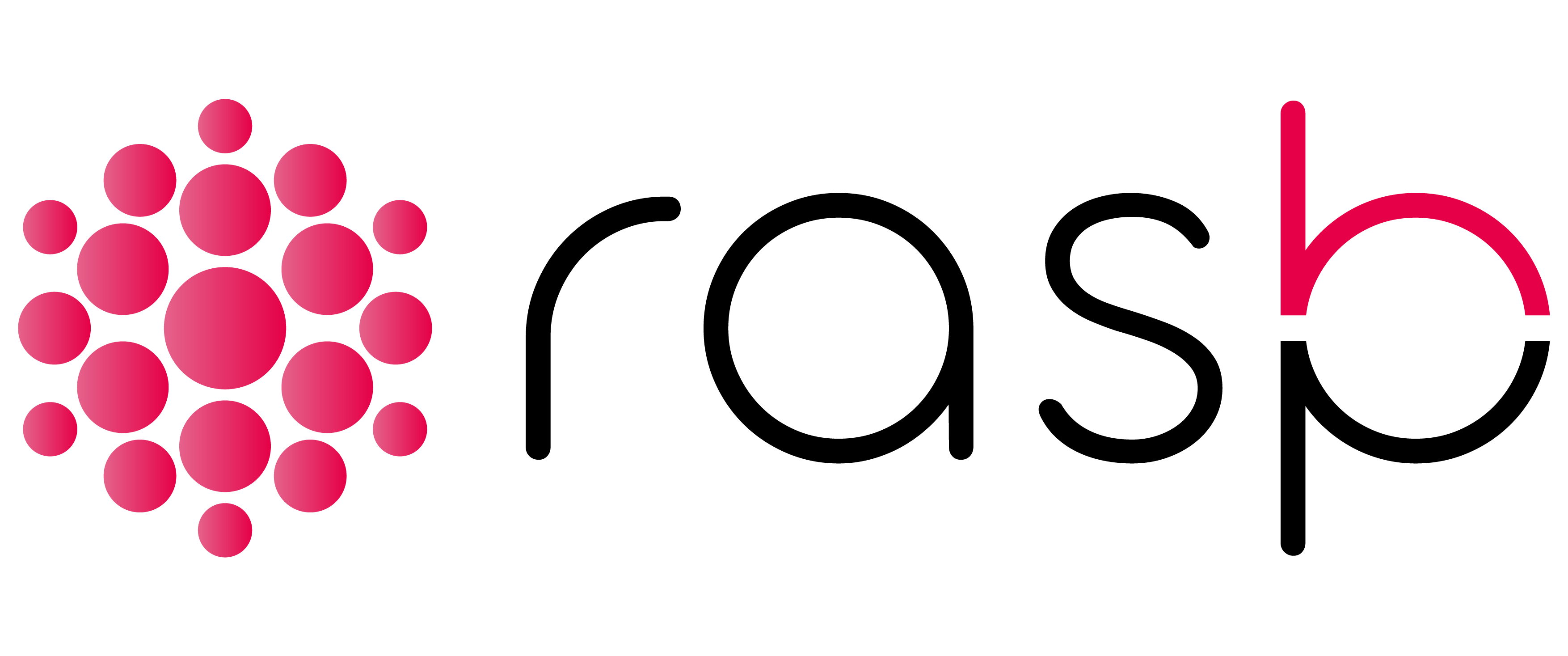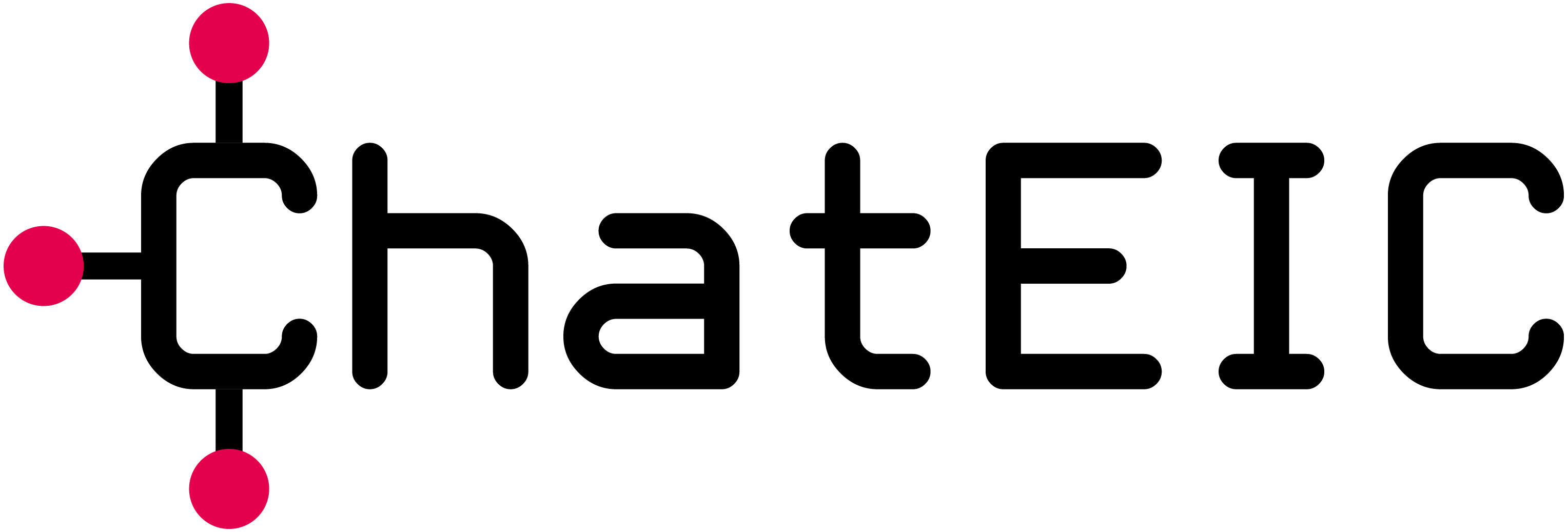Suchen Sie einen professionellen Autor, der Ihren EIC Accelerator-blended financing-Antrag (ehemals SME Instrument Phase 2, Zuschuss und Eigenkapital) unterstützen kann? Kontaktieren Sie uns gerne über dieses Kontaktformular: Kontaktiere uns
Sind Sie Autor? Kontaktieren Sie uns: Verbinden.
Das EIC Accelerator (2,5 Mio. € Zuschuss und 15 Mio. € Eigenkapitalfinanzierung verfügbar) ist der Startfinanzierungszweig der Europäischen Kommission (EK) und des European Innovation Council (EIC), der innovative und disruptive kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützt in:
- EU-27: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republik Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.
- Assoziierte Länder: Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Marokko, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich.
Hinweis: Bitte suchen Sie nach Updates zu dieser Liste da Länder wie die Schweiz und insbesondere Nicht-EU-Länder ihren Status im Laufe der Zeit ändern können. Es kann auch zu häufigen Änderungen bei der Förderfähigkeit kommen, etwa der Beteiligung des Vereinigten Königreichs am Zuschuss, nicht jedoch der Beteiligungsfinanzierung.
Kontaktieren Sie uns hier
Um
Die Artikel gefunden auf Rasph.com spiegeln die Meinungen von Rasph oder seinen jeweiligen Autoren wider und spiegeln in keiner Weise die Meinungen der Europäischen Kommission (EC) oder des Europäischen Innovationsrats (EIC) wider. Die bereitgestellten Informationen zielen darauf ab, wertvolle Perspektiven auszutauschen und können Antragsteller potenziell über Zuschussfinanzierungsprogramme wie EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition oder verwandte Programme wie Innovate UK im Vereinigten Königreich oder den Small Business Innovation and Research Grant informieren ( SBIR) in den Vereinigten Staaten.
Die Artikel können auch eine nützliche Ressource für andere Beratungsunternehmen im Zuschussbereich sowie für professionelle Zuschussantragsteller sein, die als Freiberufler angestellt sind oder Teil eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) sind. Das EIC Accelerator ist Teil von Horizont Europa (2021-2027), das vor Kurzem das vorherige Rahmenprogramm Horizont 2020 ersetzt hat.
- Kontaktiere uns -
EIC Accelerator Artikel
Alle berechtigten EIC Accelerator-Länder (einschließlich Großbritannien, Schweiz und Ukraine)
Erläuterung des Wiedervorlageprozesses für EIC Accelerator
Eine kurze, aber umfassende Erklärung des EIC Accelerator
Der One-Stop-Shop-Finanzierungsrahmen des EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Entscheidung zwischen EIC Pathfinder, Transition und Accelerator
Ein Gewinnerkandidat für das EIC Accelerator
Go Fund Yourself: Sind EIC Accelerator-Eigenkapitalinvestitionen notwendig? (Vorstellung von Grant+)
Tiefer graben: Der neue DeepTech-Schwerpunkt des EIC Accelerator und seine Finanzierungsengpässe
Zombie-Innovation: EIC Accelerator-Finanzierung für die lebenden Toten
Smack My Pitch Up: Änderung des Bewertungsfokus des EIC Accelerator
Wie tief ist Ihre Technologie? Der European Innovation Council Impact Report (EIC Accelerator)
Steuerung des EIC Accelerator: Erkenntnisse aus dem Pilotprogramm
Wer sollte sich nicht für das EIC Accelerator bewerben und warum
Das Risiko, alle Risiken im Hochrisikoprogramm EIC Accelerator darzustellen
So bereiten Sie eine EIC Accelerator-Wiedereinreichung vor
So erstellen Sie eine gute EIC Accelerator-Bewerbung: Allgemeine Projekthinweise
EIC Accelerator March 2025 Results: The Newest Winners
Europe Backs 40 High-Growth Tech Pioneers in Latest EIC Accelerator Funding Round
DIE NEUESTEN ERGEBNISSE FINDEN SIE HIER
Brussels, Belgium – June 30, 2025 – The European Innovation Council (EIC) has announced the selection of 40 innovative companies to receive a total of approximately €229 million in funding under the latest EIC Accelerator program. The results, published today, follow a highly competitive selection process with a grant application cutoff date of March 12, 2025.
The funded startups and SMEs represent the pinnacle of European deep-tech and breakthrough innovation, poised to scale up and compete on the global stage. With an average ticket size of €5.73 million per company, this substantial investment underscores the EIC’s commitment to fostering a new generation of European tech giants.
A staggering 87.5% of the successful applicants, totaling 35 companies, will receive blended finance, a combination of grant funding and equity investment. This popular funding model ensures that companies not only have the resources for research and development but also the long-term financial backing to successfully bring their innovations to market. In this round, four companies (10%) secured grant-only funding, while one company (2.5%) will receive equity-only investment.
The selection process for the EIC Accelerator is notoriously rigorous. While the total number of applicants for the initial stages (Step 1 and Step 2) was not disclosed, the success rate for companies that reached the final interview stage (Step 3) stood at 27%.
Diverse Representation Across Europe
The 40 winning companies hail from 16 different countries, showcasing a broad geographical distribution of innovation across the continent. Germany leads the pack with seven funded companies (17.5%), followed closely by Spain with five (12.5%). The Netherlands and Sweden each saw four companies selected (10%), while France and the United Kingdom both have three successful applicants (7.5%).
Other countries represented among the winners include Denmark, Finland, Ireland, and Poland, each with two companies. Austria, Belgium, Czechia, Israel, Italy, and Luxembourg each have one company receiving funding.
This diverse cohort of winners reflects the EIC’s mission to support excellence in innovation wherever it may arise within the European Research Area and associated countries. The variety of sectors and technologies represented, from life sciences and digital technologies to energy and sustainability, highlights the multifaceted nature of Europe’s innovation landscape.
The successful companies will now enter into grant agreement preparations and will be supported by the EIC Fund for the equity investment component. This financial injection will be complemented by access to the EIC’s Business Acceleration Services, providing coaching, mentoring, and networking opportunities to help them navigate the challenges of scaling up.
The next opportunity for ambitious startups and SMEs to apply for the EIC Accelerator will be the upcoming grant application cutoff for Step 2 on October 1, 2025.
Rohdaten
Art der Finanzierung
- Blended Finance: 35 companies (87.5%)
- Equity Only: 1 company (2.5%)
- Grant Only: 4 companies (10%)
Budget
- Total Budget: €229 million
- Average ticket size: €5.73 million
Fristen
- Grant application cutoff date for Step 2: 12. MärzTh 2025
- Datum der Veröffentlichung der Ergebnisse: June 30Th 2025
Erfolgsraten
- Schritt 3: 40 out of 150 (27%)
- Step 1 and Step 2 applicant numbers were not published.
EIC Accelerator Winners
There are 16 different countries among the funded companies.
Total winners: 40 companies
EIC Accelerator Country Distribution
- Germany (7 companies and 17.5%)
- Spain (5 companies and 12.5%)
- Netherlands (4 companies and 10%)
- Sweden (4 companies and 10%)
- France (3 companies and 7.5%)
- United Kingdom (3 companies and 7.5%)
- Denmark (2 companies and 5%)
- Finland (2 companies and 5%)
- Ireland (2 companies and 5%)
- Poland (2 companies and 5%)
- Austria (1 company and 2.5%)
- Belgium (1 company and 2.5%)
- Czechia (1 company and 2.5%)
- Israel (1 company and 2.5%)
- Italy (1 company and 2.5%)
- Luxembourg (1 company and 2.5%)
Full EIC Accelerator Beneficiary List
| Unternehmen | Akronym | Beschreibung | Land | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| TURBULENCE SOLUTIONS GMBH | TurbulenceCancelling | Innovation Activities to mature Turbulence Cancelling Technology for Light and Business Aircraft from TRL 6 to TRL 8 as Key Enabling Technology for the Future of Sustainable Air Mobility | Österreich | 2025 |
| AMPHISTAR | Surfact | Upcycled BioSURFACTants: time to ACT! | Belgien | 2025 |
| ROBOTWIN SRO | Neurofabrix | Digital solution for robotizing manufacturing operations that learns from human demonstrations, allows workers to supervise its outputs and receives feedback to immediately correct its imperfections. | Tschechien | 2025 |
| AGROBIOMICS APS | SUBTARC | Scaling Up Biostimulant Technology for Agriculture Resilient to Climate change | Dänemark | 2025 |
| COPENHAGEN ATOMICS AS | Th-MSR | Powering Tomorrow with the Next-Gen Thorium Molten Salt Reactors to Burn Nuclear Waste | Dänemark | 2025 |
| CeLLife Technologies Oy | PerBatt | Revolutionizing Battery Diagnostics with a novel impedance signal processing system | Finnland | 2025 |
| GEYSER BATTERIES OY | GEYSER | Aqueous Power Batteries to enable the Future Energy System | Finnland | 2025 |
| Oligofeed | OLIGOFEED_EU | OLIGOFEED | Frankreich | 2025 |
| SUBLIME Energie | SUBLIME Energie | Unique biogas liquefaction and transport technology to unlock on-farm methanisation | Frankreich | 2025 |
| SCIENTA LAB | PRISMA | Predictive Research for Inflammatory Systems Medicine | Frankreich | 2025 |
| ExpectedIT GmbH | Lpool | LPool - Rack-scale servers to Revolutionize AI Datacenters for Fast, Sustainable, Cost-efficient Computing | Deutschland | 2025 |
| RooflineAI GmbH | ROOFLINE | Retargetable AI Compiler Technology for Scalable Edge Deployment of Next-Generation AI Models | Deutschland | 2025 |
| SPINNCLOUD SYSTEMS GMBH | SpiNNext | Brain-inspired Computing for Next Generation Generative Artificial Intelligence | Deutschland | 2025 |
| BEEOLED GMBH | beeUP | Upscaling of blue elementary emitter to revolutionize OLED manufacturing | Deutschland | 2025 |
| plasmotion GmbH | 3D JETPEP Finishing | 3D JETPEP - REVOLUTIONIZING HIGH-VALUE MANUFACTURING WITH MULTI-AXIS JET PLASMA FINISHING | Deutschland | 2025 |
| EBENBUILD GMBH | Twinhale | In silico trials for pulmonary drug delivery with breakthrough digital twins of the lungs | Deutschland | 2025 |
| Symphera GmbH | Symphera | Symphera: Revolutionizing laparoscopic surgery through automated in-body tool switching | Deutschland | 2025 |
| RESTORED HEARING LIMITED | MUSE | Materials for the Ultimate Sound reduction in the Environment | Irland | 2025 |
| CROIVALVE LIMITED | DUO 4 ALL | DUO 4 ALL | Irland | 2025 |
| RepAir DAC Ltd. | StackDAC | Direct Air Carbon Capture designed for the Gigaton Scale | Israel | 2025 |
| CIRCULAR MATERIALS SRL | Kreislaufmaterialien | Circular Materials Hub- an innovative low carbon intensity process that efficiently recovers over 99% of critical raw materials from industrial wastewater | Italien | 2025 |
| Space Cargo Unlimited | BentoBox | A scalable and optimised platform for microgravity research and the return of useful charges | Luxemburg | 2025 |
| Photosynthetic B.V. | Photosynthetic | Unlocking production-speed additive manufacturing at the micro-scale | Niederlande | 2025 |
| Groove Quantum B.V. | DISQO | Manufacturing quantum advantage via scalable germanium quantum processors | Niederlande | 2025 |
| Q* BIRD BV | QBird B.V. | Next-Generation Quantum Key Distribution for a Secure Digital Future | Niederlande | 2025 |
| TargED Biopharmaceuticals B.V. | TANO-TAC | Thrombolytic Nanobody Therapy for Dissolving All Types of Blood Clots | Niederlande | 2025 |
| Proteine Resources Sp. z o.o. | ProteinBoost | SUSTAINABLE UPCYCLING OF AGRICULTURAL BYPRODUCTS INTO ENHANCED PROTEINS FOR OPTIMAL NUTRITION OF ANIMALS | Polen | 2025 |
| Apisense SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | S.A.F.E. | Revolutionizing Apiculture with the first AI-driven monitoring system using bee pheromones and satellite data | Polen | 2025 |
| BYTELAB SOLUTIONS SL | NEXTBIOMOL | THE COMPUTATIONAL LABORATORY FOR THE NEXT GENERATION SUSTAINABLE CHEMICALS AND DIGITAL TRANSITION | Spanien | 2025 |
| Singularly, S.L. | NeuralTrust | LEADING CYBERSECURITY IN THE GENERATIVE AI ERA | Spanien | 2025 |
| Basquevolt SA | Electro-Lite | Semi-solid polymer electrolyte enabling more affordable, sustainable and performant EV batteries | Spanien | 2025 |
| HYDROGEN ONSITE, SL | H2SITE | A NEXT-GEN AMMONIA CRACKING: UNLOCKING HIGH H2 RECOVERY, ON DEMAND, LOW-CARBON HYDROGEN | Spanien | 2025 |
| ONCOMATRYX BIOPHARMA SL | ONCO-DART | Pioneering antibody-drug conjugates targeting the tumour microenvironment to deliver transformative new therapies in oncology | Spanien | 2025 |
| Nordic Bio-Graphite AB | Fossil-Free Graphite | Fossil-Free Graphite by Nordic Bio-Graphite: Advancing Sustainability and Resilience in Critical Raw Materials Supply Chains | Schweden | 2025 |
| Zparq AB | ZPARQ-Z10 | ZPARQ Z10: Challenging the Limits of Marine Propulsion | Schweden | 2025 |
| Single Technologies AB | Theta128 | Breaking the 2-dimensional sequencing barrier with ultra low-cost (<$10), fast 3D image-based sequencing | Schweden | 2025 |
| Pixelgen Technologies AB | PNA | Proximity Network Assay: driving the future of high-resolution protein interactomics in 3D for precision medicine, drug discovery, and molecular diagnostics | Schweden | 2025 |
| Quantum Dice Limited | Q-TASTic | Quantum Technologies Accelerating Stochastic Tasks | Großbritannien | 2025 |
| Rheenergise Limited | LDES-HDHydro | Long-Duration Energy Storage using High-Density Hydro | Großbritannien | 2025 |
| Mitra Bio | MitraTest | A NOVEL NON-INVASIVE DNA METHYLATION TEST FOR MELANOMA | Großbritannien | 2025 |
Um
Die Artikel gefunden auf Rasph.com spiegeln die Meinungen von Rasph oder seinen jeweiligen Autoren wider und spiegeln in keiner Weise die Meinungen der Europäischen Kommission (EC) oder des Europäischen Innovationsrats (EIC) wider. Die bereitgestellten Informationen zielen darauf ab, wertvolle Perspektiven auszutauschen und können Antragsteller potenziell über Zuschussfinanzierungsprogramme wie EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition oder verwandte Programme wie Innovate UK im Vereinigten Königreich oder den Small Business Innovation and Research Grant informieren ( SBIR) in den Vereinigten Staaten.
Die Artikel können auch eine nützliche Ressource für andere Beratungsunternehmen im Zuschussbereich sowie für professionelle Zuschussantragsteller sein, die als Freiberufler angestellt sind oder Teil eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) sind. Das EIC Accelerator ist Teil von Horizont Europa (2021-2027), das vor Kurzem das vorherige Rahmenprogramm Horizont 2020 ersetzt hat.
Dieser Artikel wurde geschrieben von ChatEIC. ChatEIC ist ein EIC Accelerator-Assistent, der Sie beim Verfassen von Vorschlägen beraten, aktuelle Trends diskutieren und aufschlussreiche Artikel zu verschiedenen Themen erstellen kann. Die von ChatEIC verfassten Artikel können ungenaue oder veraltete Informationen enthalten.
- Kontaktiere uns -
EIC Accelerator Artikel
Alle berechtigten EIC Accelerator-Länder (einschließlich Großbritannien, Schweiz und Ukraine)
Erläuterung des Wiedervorlageprozesses für EIC Accelerator
Eine kurze, aber umfassende Erklärung des EIC Accelerator
Der One-Stop-Shop-Finanzierungsrahmen des EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Entscheidung zwischen EIC Pathfinder, Transition und Accelerator
Ein Gewinnerkandidat für das EIC Accelerator
Go Fund Yourself: Sind EIC Accelerator-Eigenkapitalinvestitionen notwendig? (Vorstellung von Grant+)
Tiefer graben: Der neue DeepTech-Schwerpunkt des EIC Accelerator und seine Finanzierungsengpässe
Zombie-Innovation: EIC Accelerator-Finanzierung für die lebenden Toten
Smack My Pitch Up: Änderung des Bewertungsfokus des EIC Accelerator
Wie tief ist Ihre Technologie? Der European Innovation Council Impact Report (EIC Accelerator)
Steuerung des EIC Accelerator: Erkenntnisse aus dem Pilotprogramm
Wer sollte sich nicht für das EIC Accelerator bewerben und warum
Das Risiko, alle Risiken im Hochrisikoprogramm EIC Accelerator darzustellen
So bereiten Sie eine EIC Accelerator-Wiedereinreichung vor
So erstellen Sie eine gute EIC Accelerator-Bewerbung: Allgemeine Projekthinweise
Four European Deep-Tech Companies Tapped for Major Investment Under EIC STEP Scale Up Initiative
BRUSSELS – 12 June 2025 – The European Commission has announced the results of the second evaluation round for its ambitious EIC Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) Scale Up scheme, putting forward four leading deep-tech companies for significant equity investments totaling up to €90 million. These firms, selected for their potential to bolster Europe’s strategic technology landscape, will now advance to the European Innovation Council (EIC) Fund for final investment decisions and due diligence.
The highly competitive selection process saw 19 companies submit proposals. From this initial pool, five companies (a 26.3% success rate at this stage) were invited to interview with a panel of independent, high-level experts. Ultimately, four of the five interviewed companies successfully passed the rigorous evaluation, marking an impressive 80% success rate for those reaching the final interview stage. The overall success rate for the round, from initial submission to final recommendation, stands at 21.1%.
The selected companies are at the forefront of critical technology sectors and are now poised for significant growth:
- Multiversum-Computing (Spain): A pioneer in the field of quantum and AI computing.
- Hyimpulse Technologies (Germany): An innovator in satellite launch services.
- Dronamik (Bulgaria, Ireland): A developer of advanced drones for cargo delivery.
- Classiq Technologies (Israel): A specialist in quantum software development.
The EIC STEP Scale Up program is designed to bridge a critical market gap in financing for companies ready to scale their breakthrough innovations. It provides substantial equity investments ranging from €10 million to €30 million per company. The goal is to leverage private co-investment, enabling these firms to secure larger financing rounds of €50 million to €150 million or more, which are crucial for global competition.
All companies that passed the evaluation will receive the STEP Seal, a mark of quality designed to help them attract complementary or alternative sources of funding. They will also gain access to the EIC’s valuable Business Acceleration Services.
Background on the EIC STEP Initiative
This funding call is a key component of the EU’s strategy to enhance its sovereignty in critical areas like digital technologies, clean and resource-efficient tech, and biotechnologies. The EIC STEP Scale-up call operates with a budget of €300 million for 2025, with projections to grow to €900 million over the 2025-2027 period. The call remains continuously open, with evaluation sessions conducted quarterly to identify and support Europe’s next generation of tech leaders.
All EIC STEP Scale-Up Winners
| Unternehmen | Land | Projekt | Finanzierung | Jahr | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiversum-Computing | Spanien | quantum/AI | Eigenkapital | 2025 | 2 |
| Hyimpulse Technologies | Deutschland | satellite launch services | Eigenkapital | 2025 | 2 |
| Dronamik | Bulgaria, Ireland | drones for cargo delivery | Eigenkapital | 2025 | 2 |
| Classiq technologies | Israel | quantum software | Eigenkapital | 2025 | 2 |
Um
Die Artikel gefunden auf Rasph.com spiegeln die Meinungen von Rasph oder seinen jeweiligen Autoren wider und spiegeln in keiner Weise die Meinungen der Europäischen Kommission (EC) oder des Europäischen Innovationsrats (EIC) wider. Die bereitgestellten Informationen zielen darauf ab, wertvolle Perspektiven auszutauschen und können Antragsteller potenziell über Zuschussfinanzierungsprogramme wie EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition oder verwandte Programme wie Innovate UK im Vereinigten Königreich oder den Small Business Innovation and Research Grant informieren ( SBIR) in den Vereinigten Staaten.
Die Artikel können auch eine nützliche Ressource für andere Beratungsunternehmen im Zuschussbereich sowie für professionelle Zuschussantragsteller sein, die als Freiberufler angestellt sind oder Teil eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) sind. Das EIC Accelerator ist Teil von Horizont Europa (2021-2027), das vor Kurzem das vorherige Rahmenprogramm Horizont 2020 ersetzt hat.
Dieser Artikel wurde geschrieben von ChatEIC. ChatEIC ist ein EIC Accelerator-Assistent, der Sie beim Verfassen von Vorschlägen beraten, aktuelle Trends diskutieren und aufschlussreiche Artikel zu verschiedenen Themen erstellen kann. Die von ChatEIC verfassten Artikel können ungenaue oder veraltete Informationen enthalten.
- Kontaktiere uns -
EIC Accelerator Artikel
Alle berechtigten EIC Accelerator-Länder (einschließlich Großbritannien, Schweiz und Ukraine)
Erläuterung des Wiedervorlageprozesses für EIC Accelerator
Eine kurze, aber umfassende Erklärung des EIC Accelerator
Der One-Stop-Shop-Finanzierungsrahmen des EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Entscheidung zwischen EIC Pathfinder, Transition und Accelerator
Ein Gewinnerkandidat für das EIC Accelerator
Go Fund Yourself: Sind EIC Accelerator-Eigenkapitalinvestitionen notwendig? (Vorstellung von Grant+)
Tiefer graben: Der neue DeepTech-Schwerpunkt des EIC Accelerator und seine Finanzierungsengpässe
Zombie-Innovation: EIC Accelerator-Finanzierung für die lebenden Toten
Smack My Pitch Up: Änderung des Bewertungsfokus des EIC Accelerator
Wie tief ist Ihre Technologie? Der European Innovation Council Impact Report (EIC Accelerator)
Steuerung des EIC Accelerator: Erkenntnisse aus dem Pilotprogramm
Wer sollte sich nicht für das EIC Accelerator bewerben und warum
Das Risiko, alle Risiken im Hochrisikoprogramm EIC Accelerator darzustellen
So bereiten Sie eine EIC Accelerator-Wiedereinreichung vor
So erstellen Sie eine gute EIC Accelerator-Bewerbung: Allgemeine Projekthinweise
ChatEIC-Rezension: Nutzung eines KI-Writers für den EIC Accelerator-Erfolg
Suchen Sie nach allen EIC Accelerator-Vorlagen, die Sie für einen hochwertigen Förderantrag benötigen? Die Schulung und alle Vorlagen für Förderanträge finden Sie auf ChatEIC.
Möchten Sie einen KI-geschriebenen EIC Accelerator-Förderantrag erstellen? Dann schauen Sie sich an ChatEIC und seine KI-Funktionen zum Verfassen von Zuschussanträgen:
Die EIC Accelerator-Herausforderung: Navigation durch Europas führende Deep-Tech-Finanzierung
Übersicht über EIC Accelerator
Der European Innovation Council (EIC) Accelerator ist eine zentrale Initiative im Rahmen von Horizont Europa und steht für das Engagement der Europäischen Union zur Förderung bahnbrechender Innovationen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, risikoreiche und vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups zu identifizieren und zu unterstützen, insbesondere im Bereich „Deep Tech“ – Innovationen, die auf bedeutenden wissenschaftlichen oder technischen Herausforderungen basieren. Das Programm zielt darauf ab, die kritische Finanzierungslücke zu schließen, mit der diese Unternehmen oft konfrontiert sind, und ihnen die Entwicklung und Skalierung bahnbrechender Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die neue Märkte schaffen oder bestehende auf europäischer und globaler Ebene revolutionieren können.
Die angebotene finanzielle Unterstützung ist beträchtlich und darauf ausgelegt, Unternehmen durch anspruchsvolle Wachstumsphasen zu bringen. Die Finanzierung kombiniert typischerweise nicht verwässernde Zuschüsse von bis zu 2,5 Millionen Euro mit Eigenkapitalinvestitionen, die über den speziellen EIC-Fonds verwaltet werden und in der Regel zwischen 0,5 und 15 Millionen Euro liegen. In einigen Fällen, insbesondere im Rahmen von Programmen wie der Scale-up-Initiative der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), können die Investitionen sogar noch höhere Beträge von bis zu 30 Millionen Euro erreichen. Dieser „blended finance“-Ansatz ist ein Markenzeichen des Accelerators und deckt sowohl die Anforderungen an Entwicklung als auch an Markteinführung ab. Der EIC-Fonds selbst hat sich zu einem wichtigen Akteur entwickelt und ist Europas größter Deep-Tech-Investor. Er zieht oft erhebliche Koinvestitionen an und verstärkt die finanzielle Wirkung für die Begünstigten. Über die direkte Finanzierung hinaus erhalten die Empfänger Zugang zu wertvollen Business Acceleration Services (BAS), darunter Coaching, Mentoring, Networking-Möglichkeiten und Kontakte zu Partnern und Investoren.
Das Programm zielt auf Innovationen ab, die über die Grundlagenforschung hinausgehen. In der Regel müssen Antragsteller einen Technologiereifegrad (TRL) von mindestens 5 oder 6 nachweisen – d. h. die Technologie wurde in einem relevanten Umfeld validiert oder demonstriert. Die Förderung unterstützt die Weiterentwicklung bis TRL 7 und 8 (Demonstration des Systemprototyps im operativen Umfeld) sowie die Skalierung bis TRL 9 (System im operativen Umfeld/Markteinführung erprobt). Dieser Fokus positioniert das EIC Accelerator als entscheidenden Katalysator für die Überbrückung der Lücke zwischen Innovationen im Spätstadium und erfolgreichem Markteintritt.
Der Spießrutenlauf: Anwendungskomplexität und Wettbewerb
Die Sicherung der EIC Accelerator-Finanzierung ist ein mühsames Unterfangen, das durch ein anspruchsvolles, mehrstufiges Bewerbungsverfahren und intensiven Wettbewerb gekennzeichnet ist. Bewerber müssen einen Spießrutenlauf durchmachen und jede Phase erfolgreich bestehen, um zur nächsten zu gelangen.
- Schritt 1: Kurzvorschlag: In dieser ersten Auswahlphase müssen Sie ein prägnantes Bewerbungspaket einreichen. Dieses enthält in der Regel eine fünfseitige Zusammenfassung zu Innovation, Marktpotenzial und Team, ein Pitch Deck (bis zu zehn Folien) und einen kurzen Video-Pitch (bis zu drei Minuten) mit dem Kernteam. Dieser Schritt kann jederzeit eingereicht werden und wird relativ schnell, in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen, bewertet. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein „GO“ von mindestens drei von vier externen Gutachtern.
- Schritt 2: Vollständiger Vorschlag: Bewerber, die Schritt 1 bestehen, werden aufgefordert, einen umfassenden Vollantrag zu erstellen und bis zu bestimmten Stichtagen (in der Regel 2–4 pro Jahr) einzureichen. Dies beinhaltet die Entwicklung eines detaillierten Geschäftsplans (oft über 50–100 Seiten), die Bereitstellung umfassender Finanzinformationen, die Darstellung der Unternehmensstruktur und die Definition von Projektmeilensteinen. Diese Phase erfordert erheblichen Aufwand und erfordert oft 60 Tage oder mehr Vorbereitungszeit. Drei verschiedene Experten bewerten den Vollantrag anhand der Kriterien Exzellenz, Wirkung und Umsetzung. Ein einstimmiges „GO“ ist in der Regel erforderlich, um direkt zur Endphase zu gelangen. In Grenzfällen können jedoch Konsenstreffen stattfinden.
- Schritt 3: Jury-Interview: Die letzte Phase umfasst ein persönliches (oftmals virtuelles) Interview mit einer EIC-Jury, bestehend aus erfahrenen Investoren, Unternehmern und Experten. Die Bewerber präsentieren ihr Projekt (in der Regel ein 10-minütiger Pitch basierend auf dem Step 2 Deck) und durchlaufen eine ausführliche Fragerunde, die sich auf Aspekte wie Vermarktungsstrategie, Skalierbarkeit, Teamfähigkeiten und Finanzierungspläne konzentriert. Die Jury gibt die endgültige Finanzierungsempfehlung ab.
Der gesamte Prozess erfordert nicht nur eine bahnbrechende Idee, sondern auch einen sorgfältig ausgearbeiteten, überzeugenden Business Case, der Marktpotenzial, Skalierbarkeit, Teamstärke und Übereinstimmung mit den Prioritäten der EU belegt. Die enorme Menge an Bewerbungen unterstreicht den harten Wettbewerb. In Phase 1 bewerben sich oft Tausende, was zu extrem niedrigen Erfolgsquoten führt, die nicht selten im einstelligen Bereich liegen (z. B. 2-7%). Der Druck wird zusätzlich dadurch erhöht, dass der EIC strenge Beschränkungen für die erneute Einreichung anwendet, die oft als „Drei-Verstöße-Regel“ bezeichnet werden. Wenn sich in den einzelnen Phasen drei Ablehnungen ansammeln, kann ein Projekt innerhalb des Zeitrahmens von Horizont Europa von einer erneuten Bewerbung ausgeschlossen werden.
Der Bedarf an effizienten Lösungen
Die Kombination aus erheblichen potenziellen Belohnungen, einem komplexen und langwierigen Antragsverfahren (das sich von Beginn bis zur Finanzierungsentscheidung oft über sechs Monate bis über ein Jahr hinzieht), intensivem Wettbewerb und den damit verbundenen hohen Einsätzen schafft ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld für Antragsteller. Startups und KMU, die häufig mit begrenzten Ressourcen und Zeit arbeiten, stehen bei der Erstellung von Anträgen, die den strengen Standards des EIC genügen, vor erheblichen Hürden. Auch die Berater, die diese Unternehmen unterstützen, stehen unter dem Druck, qualitativ hochwertige Anträge effizient abzuliefern. Dieses Hochdruckumfeld, in dem jeder Vorteil entscheidend sein kann, treibt natürlich die Nachfrage nach Tools und Strategien an, die den Prozess rationalisieren, die Qualität der Anträge verbessern, die Konformität sicherstellen und letztendlich die Erfolgschancen verbessern. Das Aufkommen künstlicher Intelligenz (KI) bietet eine mögliche Möglichkeit, diesen Bedarf zu decken, und bietet neue Methoden, um die Komplexität der EIC Accelerator-Zuschussanträge zu bewältigen.
Der Fokus des EIC Accelerator auf Deep-Tech und bahnbrechenden Innovationen, die oft von hochtechnischen oder wissenschaftlichen Teams entwickelt werden, verstärkt diesen Bedarf zusätzlich. Diese Teams verfügen zwar über herausragendes technisches Fachwissen, verfügen jedoch nicht immer über die erforderlichen Fachkenntnisse in den Bereichen Förderanträge, Geschäftsplanung oder Finanzprognose, um die strengen EIC-Bewertungskriterien effektiv zu erfüllen. Diese Qualifikationslücke erfordert oft die Inanspruchnahme externer Unterstützung durch Berater oder die Suche nach Tools, die bei den nicht-technischen Aspekten der Bewerbung unterstützen. Dies macht die Aussicht auf einen KI-gestützten Assistenten besonders attraktiv.
Geben Sie ChatEIC ein: Der spezialisierte KI-Grant-Autor für EIC-Bewerber
Einführung von ChatEIC
Inmitten der Herausforderungen des EIC Accelerator-Bewerbungsprozesses erweist sich ChatEIC als spezialisierte Softwarelösung. Es wird explizit als Autor von KI-Zuschussanträgen Speziell für die Erstellung von Anträgen für das European Innovation Council (EIC) Accelerator-Programm entwickelt. Sein Hauptzweck besteht darin, Antragstellern – Startups, KMU und den sie unterstützenden Beratern – die Möglichkeit zu geben, hochwertige Entwürfe für den wichtigen EIC Accelerator-Schritt-1-Antrag deutlich schneller und effizienter zu erstellen als mit herkömmlichen manuellen Methoden.
Zielgruppe
Das Tool richtet sich klar an die wichtigsten Akteure im EIC Accelerator-Anwendungsökosystem. Dazu gehören:
- Startups und kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Unternehmen mit innovativen Technologien oder Geschäftsmodellen, die eine EIC Accelerator-Finanzierung beantragen möchten.
- Berater und professionelle Stipendienantragsteller: Einzelpersonen oder Firmen, die auf die Unterstützung von Startups und KMU bei der Vorbereitung und Einreichung von Zuschussanträgen spezialisiert sind, einschließlich der Anträge für das EIC Accelerator.
Glaubwürdigkeit und Fachwissen des Erstellers
ChatEIC wird nicht als generisches KI-Tool präsentiert, sondern als Produkt, das von einer Person mit direkter Erfahrung auf diesem Gebiet entwickelt wurde. Es wurde von Ph.D. Stephan Segler entwickelt, der seit 2017 als professioneller Fördermittelantragsteller tätig ist. Dr. Segler ist mit Segler Consulting und Rasph verbunden, Unternehmen, die Beratungsleistungen für EIC Accelerator anbieten. Diese Verbindung positioniert ChatEIC als ein Tool, das potenziell mit praktischen Erkenntnissen und Wissen angereichert ist, das aus realen Erfahrungen im Umgang mit den Komplexitäten von EIC-Anträgen gewonnen wurde. Die Verbindung mit einem bekannten Berater im EIC-Bereich zielt darauf ab, das Vertrauen der Benutzer zu stärken, und suggeriert, dass das Tool domänenspezifisches Fachwissen einbezieht, anstatt sich ausschließlich auf allgemeine Sprachmodelle zu verlassen. Für Antragsteller, die den anspruchsvollen EIC-Prozess durchlaufen, unterscheidet diese wahrgenommene Expertise ChatEIC von allgemeineren KI-Schreiblösungen.
Kernfunktionalität – So funktioniert es
Der Betriebsablauf von ChatEIC ist auf Einfachheit und Direktheit ausgelegt:
- Eingang: Der Benutzer stellt das Ausgangsmaterial für den Vorschlag bereit. Dies kann Rohtext sein, der in ein Eingabefeld eingefügt wird, hochgeladene Dokumente (wie vorhandene Pitch Decks oder Geschäftspläne) oder Informationen, die in eine von der Plattform bereitgestellte strukturierte Vorlage eingegeben werden.
- Verarbeitung: Die zugrunde liegende KI-Engine von ChatEIC verarbeitet die bereitgestellten Eingaben, analysiert den Inhalt und identifiziert relevante Informationen für die verschiedenen Abschnitte eines EIC Accelerator-Schritt-1-Vorschlags.
- Ausgabegenerierung: Das Tool generiert einen Entwurfstext für den Antrag. Nutzer können wahlweise den gesamten Antragsentwurf auf einmal generieren oder einzelne Abschnitte einzeln erstellen (modulare Generierung).
- Herunterladen: Der endgültig erstellte Entwurf wird als standardmäßige, bearbeitbare Microsoft Word-Datei (.docx) zum Download bereitgestellt.
Zugrundeliegende Technologie (Implied Generative AI)
Die Plattform beschreibt sich selbst ausdrücklich als „Autor von KI-Zuschussanträgen„Verwendung“KI-gestützt”-Technologie. Weitere Details zeigen, dass ChatEIC 1.0 als benutzerdefinierte Version von ChatGPT (genauer gesagt ein GPT) implementiert ist, sodass Benutzer ein aktives OpenAI-Abonnement benötigen, um auf die Funktionen zugreifen zu können. Während der Begriff „Generative KI” wird im primären Marketingtext auf ChatEIC.com selbst nicht konsequent hervorgehoben, die beschriebene Funktionalität – die Aufnahme unterschiedlicher Eingaben und die eigenständige Generierung umfassender, strukturierter Texte für einen Vorschlag – ist charakteristisch für Generative KI für EIC Accelerator Anwendungen. Das Tool nutzt die Wissensdatenbank eines „EIC Accelerator-Schulungsprogramms“ und kann mit hochgeladenen Dokumenten (PDF, Word, PowerPoint) interagieren und über die Bing-Integration im Internet suchen.
Der strategische Fokus von ChatEIC, insbesondere auf den Antrag in Schritt 1, scheint bewusst gewählt. Schritt 1 dient als kritischer erster Filter im EIC-Prozess. Er bearbeitet eine große Anzahl von Anträgen und lehnt Kandidaten oft aufgrund von Klarheit, Vollständigkeit oder der Einhaltung bestimmter Formatierungs- und Inhaltsregeln ab, anstatt allein aufgrund der Qualität der Innovation. Häufige Fallstricke in dieser Phase sind falsche TRL-Definitionen, unzulässige Finanzierungsanträge oder schlecht strukturierte Argumente. Durch die Spezialisierung des KI-Tools auf diese regelintensive Phase will ChatEIC einen erheblichen Engpass beseitigen, da Compliance und eine strukturierte Präsentation für das Weiterkommen zur substanzielleren Bewertung in Schritt 2 von größter Bedeutung sind.
Dekonstruktion der Funktionen von ChatEIC: Ein KI-Toolkit für die Angebotserstellung
ChatEIC bietet eine Reihe von Funktionen, die Antragsteller bei der Erstellung von EIC Accelerator-Schritt-1-Anträgen unterstützen. Diese Funktionen gehen über die einfache Textgenerierung hinaus und beinhalten Elemente zur Gewährleistung der Konformität und zur Erfüllung spezifischer EIC-Anforderungen.
KI-gestützte Entwurfserstellung
Das Herzstück von ChatEIC ist die Fähigkeit, mithilfe von KI Textentwürfe für Angebotsabschnitte zu generieren. Ein wichtiger Aspekt ist die Flexibilität der Eingabemethoden. Nutzer sind nicht auf ein einziges Format beschränkt; das Tool kann Informationen aus hochgeladenen Pitch Decks, bestehenden Geschäftsplänen, in das System eingefügtem unstrukturiertem Text oder in eine spezielle Vorlage der Plattform eingegebene Daten verarbeiten. Diese Anpassungsfähigkeit kommt Bewerbern in unterschiedlichen Stadien der Bewerbungsreife entgegen – manche verfügen möglicherweise nur über ein prägnantes Pitch Deck, andere über umfangreiche Unterlagen. ChatEIC zielt darauf ab, die notwendigen Informationen aus diesen verschiedenen Quellen zu extrahieren und beansprucht sogar die Fähigkeit, aus minimalen Daten wie einem Pitch Deck allein einen umfassenden Angebotsentwurf zu generieren oder umgekehrt Informationen aus längeren Dokumenten mit über 100 Seiten zu analysieren und zu nutzen. Dies deutet auf den Versuch hin, unterschiedliche Ausgangspunkte in das vom EIC geforderte strukturierte Format zu normalisieren.
Kenntnis und Einhaltung der EIC-Regeln
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, das ChatEIC für sich in Anspruch nimmt, ist das eingebettete Wissen über die spezifischen Regeln und Erwartungen des EIC Accelerator-Programms. Die KI ist Berichten zufolge mit Anweisungen zur erforderlichen Terminologie, den korrekten Definitionen und der Anwendung von Technology Readiness Levels (TRLs), den Erwartungen an Diversitätspläne, Einstellungsstrategien und anderen spezifischen Nuancen der EIC-Bewertungen programmiert. Ziel dieser Funktion ist es, Bewerbern zu helfen, häufige technische Fehler – formale statt inhaltliche Fehler – zu vermeiden, die zu einer frühzeitigen Ablehnung führen können. Dies adressiert direkt einen bekannten Frustrationspunkt, bei dem Bewerbungen aufgrund der Nichteinhaltung schlecht kommunizierter oder komplexer Anforderungen scheitern.
Vermeidung von Warnsignalen
Aufbauend auf Regelbewusstsein wirbt ChatEIC ausdrücklich mit seiner Fähigkeit, Antragstellern zu helfen, häufige Warnsignale zu vermeiden, die negative Bewertungen auslösen können. Diese potenziellen Fallstricke betreffen verschiedene Aspekte des Antrags, darunter die Zusammensetzung und Vollständigkeit des Teams, die Begründung technologischer Ansprüche, die Struktur und Förderfähigkeit von Förderanträgen, die Realistik der Finanzprognosen, die Ausrichtung an umfassenderen EU-Politiken (wie dem Green Deal oder strategischen Autonomiezielen), die Formulierung sozialer Auswirkungen und die Einhaltung der Grundsätze der Geschlechtergleichstellung. Da Gutachter Anträge anhand von Kriterien wie Exzellenz, Wirkung und Umsetzung bewerten, die diese Bereiche charakterisieren, zielt diese Funktion darauf ab, die generierten Inhalte proaktiv so zu strukturieren, dass sie den Erwartungen der Gutachter entsprechen und Risiken im Zusammenhang mit häufigen Antragstellerfehlern minimieren. Der Fokus auf diese Compliance-Aspekte positioniert das Tool nicht nur als Textgenerator, sondern als Navigationshilfe, die Nutzern hilft, die wahrgenommene Komplexität und potenzielle Willkür des EIC-Bewertungsrahmens zu bewältigen.
Praktische und bequeme Ausgaben
ChatEIC berücksichtigt die praktischen Bedürfnisse der Antragsteller und liefert seine Ergebnisse in einem benutzerfreundlichen Format: einer herunterladbaren und bearbeitbaren Microsoft Word-Datei (.docx). Diese Auswahl gewährleistet umfassende Kompatibilität und ermöglicht es Nutzern, Bilder, Diagramme oder andere visuelle Elemente einfach zu integrieren, letzte Bearbeitungen vorzunehmen, Änderungen zu verfolgen und vor der Einreichung mit Teammitgliedern oder Beratern zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, die generierten Inhalte unbegrenzt herunterzuladen, trägt zusätzlich zum Komfort bei.
Flexibilität in der Anwendung
ChatEIC bietet mehrere Betriebsmodi für unterschiedliche Arbeitsabläufe:
- Modulare Generation: Nutzer müssen nicht den gesamten Antrag gleichzeitig erstellen. Sie können einzelne Abschnitte oder Module erstellen, um gezielt an bestimmten Teilen des Antrags zu arbeiten oder einzelne Argumente schrittweise zu verfeinern.
- Vorlagenintegration: Für Nutzer, die mehr Struktur wünschen, bietet ChatEIC eine Vorlage, die ausgefüllt werden kann, um den Generierungsprozess der KI zu steuern. Dies bietet eine gezieltere Möglichkeit zur Eingabe im Vergleich zum Hochladen unstrukturierter Dokumente. Diese Integration stellt eine Anwendung von EIC Accelerator Vorlage AI.
- Revisionsfähigkeit: Das Tool kann bestehende Vorschläge, auch zuvor abgelehnte, verarbeiten und als Grundlage für die Erstellung einer überarbeiteten Version verwenden. Diese Funktion bietet Antragstellern die Möglichkeit, frühere Einreichungen zu verbessern, indem sie das EIC-spezifische Wissen und die Strukturierungsfunktionen der KI nutzen.
Tabelle: ChatEIC-Kernfunktionen
| Funktionsname | Kurzbeschreibung |
| KI-Entwurfsgenerierung | Generiert Angebotstexte basierend auf Benutzereingaben (Text, Dateien, Vorlage). |
| Eingabeflexibilität | Akzeptiert verschiedene Eingabeformate: Pitch Decks, Geschäftspläne, Text, Vorlagendaten. |
| Kenntnis der EIC-Regeln | Programmiert mit spezifischen EIC Accelerator-Regeln, Terminologie, TRLs usw., um die Konformität zu verbessern. |
| Vermeidung von Warnsignalen | Entwickelt, um Inhalte so zu strukturieren, dass häufige Fehler in Bereichen wie Team, Technik, Finanzierung, Finanzen und Richtlinien vermieden werden. |
| Modulare Generation | Ermöglicht die Generierung einzelner Angebotsabschnitte oder des gesamten Dokuments. |
| Vorlagenverwendung | Bietet eine optionale Vorlage zum Strukturieren der Eingabe für die KI. |
| Revisionsfähigkeit | Kann vorhandene/abgelehnte Vorschläge verarbeiten, um überarbeitete Entwürfe zu erstellen. |
| Wortausgabe | Liefert den endgültigen Entwurf als bearbeitbare und formatierte DOCX-Datei für eine einfache Fertigstellung und Zusammenarbeit. |
Das Wertversprechen: Warum sollten Sie ChatEIC für Ihre EIC-Anwendung in Betracht ziehen?
ChatEIC positioniert sich als wertvolles Tool für EIC Accelerator-Bewerber und hebt mehrere wichtige Vorteile hervor, die sich auf Effizienz, Kosten, Compliance und Qualitätsverbesserung konzentrieren. Das Leistungsversprechen zielt auf die spezifischen Herausforderungen ab, mit denen Startups, KMU und Berater in diesem anspruchsvollen Finanzierungsumfeld konfrontiert sind.
Geschwindigkeit und Effizienz
Einer der wichtigsten Vorteile ist die drastische Verkürzung der Schreibzeit. ChatEIC behauptet, einen vollständigen Entwurf des ersten Angebots in wenigen Minuten erstellen zu können, was potenziell 99% Zeitersparnis gegenüber manuellem Schreiben bedeutet, das oft einen Monat oder länger dauern kann, insbesondere für weniger erfahrene Autoren. Für ressourcenbeschränkte Startups, in denen Schlüsselpersonal mehrere Rollen gleichzeitig wahrnimmt, oder für Berater, die mehrere Kunden betreuen, ist dieses Beschleunigungspotenzial ein großer Vorteil.
Kosteneffizienz
Im Vergleich zur traditionellen Vorgehensweise, spezialisierte Berater für die Angebotserstellung zu engagieren, stellt ChatEIC eine deutlich günstigere Alternative dar. Mit Preisen ab 200 € für das Basispaket soll es mindestens 95% weniger kosten als die üblichen Beratungsgebühren für ein Angebot der Stufe 1, die oft mit 5.000 € oder mehr angegeben werden. Dies positioniert KI-gestütztes Schreiben als finanziell attraktive Option für junge Unternehmen oder solche mit knapperen Budgets.
Qualität und Compliance
Neben Geschwindigkeit und Kosten legt ChatEIC Wert auf Qualität und Konformität seiner Ergebnisse. Es erhebt den Anspruch, durch Nutzung seiner EIC-spezifischen Wissensbasis qualitativ hochwertige Anträge zu erstellen. Dazu gehören die Einhaltung der EIC-Regeln, die Verwendung angemessener Sprache und eine effektive Strukturierung der Inhalte, um häufige Fehler und technische Ablehnungen zu vermeiden. Das Tool zielt darauf ab, häufige Fehler von Antragstellern zu beheben, wie z. B. eine schlechte Verteilung des Inhalts auf die einzelnen Abschnitte – zu viel Text für weniger kritische Bereiche und unzureichende Details zu wichtigen Bewertungspunkten. Durch die Bereitstellung eines gut strukturierten und konformen Entwurfs soll die Grundqualität des Antrags verbessert werden. Der Entwickler, Dr. Segler, äußerte sich positiv über die Qualität der Ergebnisse, selbst bei unterschiedlichen Eingabedaten.
Reduzierter Forschungsaufwand
Die EIC-Programmlandschaft gilt als komplex und unterliegt häufigen Änderungen. Dies erschwert es Antragstellern, über Anforderungen und Best Practices auf dem Laufenden zu bleiben. Viele Online-Informationen veralten schnell. ChatEIC möchte diese Belastung verringern, indem es aktuelles Wissen über das EIC-Programm in sein System integriert. Dadurch reduziert sich der Rechercheaufwand für Antragsteller und sie können sich stärker auf ihre Kerninnovation und Geschäftsstrategie konzentrieren.
Rolle als KI-Assistent/Co-Pilot
ChatEIC wird oft nicht als vollständiger Ersatz für menschliche Anstrengung dargestellt, sondern als mächtige AI EIC Accelerator Assistent oder „Co-Pilot“. Es zeichnet sich durch die Erstellung eines soliden Erstentwurfs, die Gewährleistung struktureller Integrität, die Bearbeitung standardisierter Abschnitte und die Einbettung von Compliance-Prüfungen aus. Dies gibt dem menschlichen Benutzer – sei es Unternehmer oder Berater – die Möglichkeit, sich auf übergeordnete Aufgaben zu konzentrieren: die Verfeinerung der strategischen Erzählung, das Hinzufügen einzigartiger Erkenntnisse, die Sicherstellung der sachlichen Richtigkeit und die Verfeinerung des endgültigen Textes. Diese kollaborative Gestaltung trägt den Erwartungen an die vollständige Automatisierung Rechnung, insbesondere im Hinblick auf die hochdifferenzierten Anforderungen eines erfolgreichen Angebots, und unterstreicht gleichzeitig das Potenzial des Tools, die Fähigkeiten des Benutzers erheblich zu erweitern und dazu beizutragen KI für EIC Accelerator-Erfolg.
Die Betonung von Effizienz (Geschwindigkeit, Kosten, reduzierter Forschungsaufwand) und Risikominimierung (Compliance, Vermeidung von Warnsignalen) deutet darauf hin, dass ChatEIC stark auf Antragsteller abzielt, denen es in erster Linie um die Überwindung der Verfahrenshürden und Ressourcenbeschränkungen des EIC-Antragsprozesses geht. Obwohl Qualität erwähnt wird, beziehen sich die greifbarsten Vorteile darauf, den anspruchsvollen Prozess aus Compliance-Sicht schneller, kostengünstiger und sicherer zu machen. Dies kommt bei Antragstellern an, die eine Ablehnung aufgrund formaler Details und nicht aufgrund der Qualität ihrer Innovation fürchten. Die Positionierung als „Co-Pilot“ und die Verfügbarkeit ergänzender menschlicher Prüfdienste signalisieren jedoch implizit, dass die KI-Ergebnisse wahrscheinlich menschliches Eingreifen und strategische Verfeinerungen erfordern, um das für echte Wettbewerbsfähigkeit erforderliche Niveau an Komplexität zu erreichen, insbesondere für den komplexeren Geschäftsplan in Schritt 2 und das kritische Interview in Schritt 3.
Tabelle: Vergleich der Wertangebote des ChatEIC
| Besonderheit | ChatEIC (KI-Tool) | Handbucherstellung (intern) | Traditioneller Berater | Generische KI (z. B. ChatGPT) |
| Geschwindigkeit (Entwurf) | Sehr hoch (Minuten/Stunden) | Niedrig (Wochen/Monate) | Mittel (Tage/Wochen) | Hoch (Minuten/Stunden) |
| Kosten | Niedrig (200–500 € + Abos) | Mittel (Personalzeit) | Sehr hoch (5.000 €+) | Sehr niedrig (Abonnement) |
| EIC-Spezifität | Hoch (Programmiertes Wissen) | Variabel (hängt vom Team ab) | Hoch (Expertenwissen) | Sehr niedrig (generisch) |
| Compliance-Sicherung | Hoch (Regel-/Flaggenfokussiert) | Variable | Hoch | Sehr niedrig |
| Qualität des Erstentwurfs | Mittelhoch (strukturiert) | Variable | Potenziell sehr hoch | Niedrig-Mittel (Generisch) |
| Erforderlicher Benutzeraufwand | Mittel (Eingabevorbereitung, Überprüfung) | Sehr hoch (vollständiges Schreiben) | Niedrig (Versehen) | Hoch (Eingabeaufforderung, Bearbeitung) |
Hinweis: Die Bewertungen sind qualitativ und basieren auf der bereitgestellten Forschung.
Praktische Umsetzung: Preise, Leistungen und Anwendungsfälle
Für potenzielle Benutzer ist es von entscheidender Bedeutung, die praktischen Aspekte der Verwendung von ChatEIC zu verstehen, einschließlich der Kostenstruktur, der verfügbaren Dienste und der typischen Anwendungsszenarien, um die Eignung des Produkts für ihre Anforderungen beurteilen zu können.
Preismodell
ChatEIC verwendet für seinen zentralen KI-Generierungsservice ein kreditbasiertes Preissystem. Die Generierung jedes einzelnen Moduls oder Abschnitts innerhalb des EIC-Vorschlags verbraucht einen Kredit. Da ein typischer Schritt-1-Vorschlag etwa 50 solcher Module umfasst, entsprechen die Kreditpakete einer bestimmten Anzahl von vollständigen Vorschlagsentwürfen. Die verfügbaren Stufen sind:
- Basic: 200 € für 100 Credits (ausreichend für ca. 2 vollständige Step 1-Vorschlagsversionen).
- Prämie: 300 € für 200 Credits (ausreichend für ca. 4 vollständige Step 1-Vorschlagsversionen).
- Unternehmen: 500 € für 500 Credits (ausreichend für ca. 10 vollständige Step 1-Vorschlagsversionen).
Diese Struktur bietet Mengenrabatte in höheren Stufen und kommt so Nutzern mit unterschiedlichen Bedürfnissen entgegen – vom einzelnen Startup, das eine Anwendung entwickelt, bis hin zum Berater, der mehrere Kunden betreut oder mehrere Iterationen benötigt. Das Kreditsystem selbst, das mehrere Versionen ermöglicht, unterstützt einen iterativen Workflow. Es berücksichtigt, dass Nutzer möglicherweise Module oder ganze Entwürfe neu generieren müssen, wenn sie ihre Eingabedaten verfeinern oder die KI-Ausgabe überprüfen, anstatt ein perfektes Ergebnis in einem Durchgang zu erwarten. Der Zugriff erfordert außerdem ein aktives OpenAI-Abonnement für die zugrunde liegende GPT-Technologie.
Zusätzliche Services
Über das zentrale KI-Schreibtool hinaus bietet ChatEIC zusätzliche Dienste an, die die Lücke zwischen KI-Unterstützung und menschlicher Expertenunterstützung schließen:
- Schulungen & Vorlagen (900 €): Dieses Paket bietet Zugriff auf eine umfassende Bibliothek mit über 70 Schulungsmodulen zu verschiedenen Aspekten des EIC Accelerator-Antrags sowie Vorlagen für die Anträge der Stufen 1 und 2. Es bietet strukturiertes Lernen und Ressourcen zur Ergänzung des KI-Tools. Eigenständige Vorlagen sind offenbar auch separat erhältlich.
- Professionelle Überprüfung (700 €): Bewerber können ihren generierten Antragsentwurf vom Ersteller, Stephan Segler, PhD, überprüfen lassen. Dieser Service ergänzt das KI-generierte Ergebnis um eine Ebene menschlicher Qualitätskontrolle und Feedback durch Experten.
Diese Kombination aus einem abgestuften KI-Softwareangebot mit unterschiedlichen, teureren, menschenzentrierten Services (Schulung, Überprüfung) und den umfassenden Beratungsleistungen des Entwicklerunternehmens deutet auf ein hybrides Geschäftsmodell hin. ChatEIC kann als eigenständige, skalierbare und kostengünstigere Lösung fungieren, dient aber auch als Einstiegspunkt, der Benutzer potenziell zu umfassenderer, hochwertigerer, von Menschen geleiteter Unterstützung für komplexere Anforderungen führen kann, wie z. B. zur Vorbereitung auf Schritt 2 oder zum Coaching von Vorstellungsgesprächen.
Tabelle: ChatEIC Preise & Leistungen
Softwareebenen
| Stufenname | Preis (€) | Credits | Ungefähre Step 1 Versionen |
| Basic | 200 | 100 | ~2 |
| Prämie | 300 | 200 | ~4 |
| Unternehmen | 500 | 500 | ~10 |
Zusätzliche Services
| Dienstname | Preis (€) | Beschreibung |
| Schulungen und Vorlagen | 900 | Zugriff auf über 70 Schulungsmodule und Angebotsvorlagen für Schritt 1 und 2. |
| Professionelle Überprüfung | 700 | Fachliche Begutachtung des Vorschlagsentwurfs durch Stephan Segler, PhD. |
Empfohlene Anwendungsfälle
Basierend auf den Beschreibungen der Plattform veranschaulichen mehrere gängige Szenarien, wie ChatEIC genutzt werden kann:
- Strukturiertes Vorgehen (Vorlage + Datei): Dies wird als optimale Methode präsentiert. Der Benutzer füllt die bereitgestellte strukturierte Vorlage aus, um der KI einen klaren Überblick zu geben, und ergänzt diese durch hochgeladene Dateien (z. B. technische Dokumente, detaillierte Abschnitte des Geschäftsplans) zur weiteren Vertiefung. Die Generierung aller Module aus diesem umfassenden Input soll den robustesten Entwurf liefern.
- Minimaler Input (nur Pitch Deck): Für Bewerber mit weniger Unterlagen kann ChatEIC einen Vorschlagsentwurf erstellen, der hauptsächlich auf einem hochgeladenen Pitch Deck basiert. Die KI versucht, wichtige Informationen zu extrahieren und diese an die Struktur des Vorschlags anzupassen. Dies ist hilfreich, um schnell einen Ausgangspunkt zu finden.
- Nutzung vorhandener Inhalte (große Texteingabe): Unternehmen mit umfangreichem schriftlichem Material (Berichte, frühere Anträge, detaillierte interne Dokumente) können diese großen Dateien hochladen. ChatEIC analysiert diese umfangreichen Eingaben und wählt die relevanten Inhalte für jeden spezifischen Abschnitt des EIC-Antrags aus. So werden vorhandene Informationen effektiv in das erforderliche Format umgewandelt.
- Überprüfung und Benchmarking (vorhandener Vorschlag): Selbst wenn ein Unternehmen bereits manuell einen Vorschlag erstellt hat, kann die Generierung einer Version durch ChatEIC eine wertvolle Kontrolle darstellen. Sie ermöglicht den Vergleich von Struktur, Formulierung und Inhaltsverteilung. Sie kann helfen, potenzielle Verstöße gegen EIC-Regeln zu identifizieren oder Abschnitte hervorzuheben, in denen die EIC-spezifische Formulierung der KI möglicherweise besser ist. Nutzer können dann die besten Teile des KI-generierten Entwurfs gezielt in ihre eigene Arbeit integrieren.
Der breitere Kontext: KI-Tools und die sich entwickelnde EIC-Landschaft
Die Entstehung von Tools wie ChatEIC erfolgt in einem dynamischen Kontext, der durch die breitere Nutzung von KI bei der Inhaltserstellung und spezifische Änderungen innerhalb der eigenen Anwendungsinfrastruktur des EIC geprägt ist.
Der Aufstieg der KI beim Verfassen von Förderanträgen
Der Einsatz von KI zur Erstellung schriftlicher Inhalte hat sich dank der Zugänglichkeit und Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle wie ChatGPT von OpenAI schnell im Mainstream etabliert. Dieser Trend erstreckt sich auch auf Spezialgebiete wie das Verfassen von Förderanträgen, wo KI-Tools für Aufgaben von der Vorrecherche und dem Verfassen erster Textabschnitte bis hin zur sprachlichen Verfeinerung und Konsistenzprüfung erprobt werden. Generische Tools wie ChatGPT können zwar grundlegende Unterstützung beim Verfassen von Texten bieten, doch der Mangel an fachspezifischem Wissen schränkt ihre Wirksamkeit für hochspezialisierte Anwendungen wie EIC Accelerator, die ein tiefes Verständnis spezifischer Kriterien, Terminologie und Bewertungsnuancen erfordern, oft ein. Dies schafft eine Nische für spezialisierte KI-Tools, die auf spezifische Programmvoraussetzungen trainiert sind, wie ChatEIC oder andere Plattformen wie Alberta von Oroka.
Die KI-Plattform-Reise des EIC
Interessanterweise war das EIC selbst Vorreiter bei der Nutzung einer speziellen digitalen Plattform mit KI-Funktionen für Accelerator-Anwendungen, die 2021 eingeführt wurde. Diese „KI-basierte Plattform des EIC“ zielte darauf ab, Antragsteller durch verschiedene Module zu unterstützen, darunter Diagnosetools zur Beurteilung der Projekteignung und KI-Unterstützung bei der Entwicklung von Vorschlägen, wodurch möglicherweise die Informationsasymmetrie zwischen Innovatoren und Gutachtern verringert wurde.
Diese Plattform stieß jedoch auf operative Herausforderungen. Aufgrund eines Vertragsstreits stellte der EIC seine dedizierte KI-Plattform am 2. Juni 2023 ein. Dies machte eine dringende Umstellung auf konventionellere Einreichungssysteme erforderlich. Infolgedessen werden EIC Accelerator-Anträge nun über zwei separate Systeme verwaltet: Schritt 1 (Kurzanträge) wird über eine neue, dedizierte IT-Plattform eingereicht, die auf die spezifischen Anforderungen (Formular, Präsentation, Video) zugeschnitten ist, während Schritt 2 (Vollständige Anträge) über das standardmäßige Horizon Europe Funding & Tenders Portal mithilfe der Submission & Evaluation Platform (SEP) eingereicht wird. Während dieser Umstellung nutzte der EIC auch die Gelegenheit, die Antragsformulare auf der Grundlage von Feedback zu vereinfachen und neu zu strukturieren, um sie besser an die Erwartungen der Investoren anzupassen.
Die Erfahrungen des EIC mit der Entwicklung und Pflege einer hochentwickelten, spezialisierten KI-Anwendungsplattform verdeutlichen die Komplexität und die potenziellen Fallstricke bei der Implementierung solcher Systeme im Rahmen der Betriebs- und Beschaffungsprozesse einer großen öffentlichen Fördereinrichtung. Die aufgrund vertraglicher Probleme notwendige Rückkehr zu standardisierteren Plattformen deutet darauf hin, dass die Aufrechterhaltung von Flexibilität und spezialisierter Funktionalität in diesem Bereich für öffentliche Einrichtungen eine Herausforderung darstellen kann. Diese operative Realität schafft potenziell ein günstigeres Umfeld für privatwirtschaftliche Lösungen wie ChatEIC, die flexibler agieren und sich ausschließlich auf die Nischenanforderungen der EIC-Antragsteller konzentrieren können.
Positionierung von ChatEIC im aktuellen Ökosystem
Die Einstellung der EIC-eigenen KI-Plattform spricht wohl für spezialisierte Tools von Drittanbietern wie ChatEIC. Während die offizielle Plattform integrierten KI-Support und -Diagnose bot, basiert das aktuelle Setup auf allgemeineren Einreichungsportalen (SEP und die neue Step 1-Plattform), sogar mit vereinfachten Formularen. Antragsteller, die zuvor von der geführten Struktur und der KI-Unterstützung der offiziellen Plattform profitiert haben, stoßen jetzt möglicherweise auf eine Supportlücke. ChatEIC mit seinem ausdrücklichen Fokus auf EIC-Regeln, der Vermeidung von Warnsignalen und einer auf Expertenwissen basierenden Strukturierung von Vorschlägen schließt diese potenzielle Lücke direkt. Es bietet eine Ebene spezialisierter Anleitung und Konformitätsprüfung, die möglicherweise nicht mehr so stark in den offiziellen Bewerbungsprozess selbst integriert ist. Im Vergleich zu allgemeinen KI-Tools ohne EIC-spezifische Schulung bieten der zielgerichtete Ansatz von ChatEIC und die Unterstützung durch einen Fachexperten einen deutlichen Vorteil bei der Bewältigung der einzigartigen Anforderungen des Accelerator-Programms.
Fazit: Ist ChatEIC der richtige KI-Assistent für Ihre EIC Accelerator-Reise?
Zusammenfassung der Stärken von ChatEIC
ChatEIC stellt ein überzeugendes Angebot für Startups, KMU und Berater dar, die sich mit der EIC Accelerator-Anwendung befassen. Seine wichtigsten Stärken liegen in seiner tiefe Spezialisierung auf dieses spezielle Finanzierungsprogramm, insbesondere auf die kritische Phase des ersten Antrags. Es nutzt KI durch Expertenwissen, zurückzuführen auf die Erfahrung des Entwicklers Dr. Stephan Segler als Fördermittelautor, mit dem Ziel, das Verständnis der EIC-Regeln, Erwartungen und häufigen Fallstricke direkt in das Tool zu integrieren. Dieser Fokus spiegelt sich in Funktionen wider, die für Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und Vermeidung von Warnsignalen, wodurch eine Hauptursache für Ängste und Ablehnungen bei Bewerbern angegangen wird. Darüber hinaus bietet es erhebliches Potenzial für Zeit- und Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, gepaart mit der praktischen Bequemlichkeit der Bereitstellung von Entwürfen in einem bearbeitbares Word-Format.
Überlegungen für potenzielle Benutzer
Obwohl leistungsstark, sollten potenzielle Benutzer ChatEIC realistisch als eine AI EIC Accelerator Assistent oder Kopilotstatt einer völlig autonomen EIC Accelerator KI-VorschlagsautorDie Qualität der Ergebnisse hängt eng mit der Qualität und Vollständigkeit der vom Benutzer bereitgestellten Informationen zusammen. Zwar kann schnell ein strukturierter, konformer Entwurf erstellt werden, doch um die für den Erfolg im hart umkämpften EIC-Umfeld erforderliche Nuance, strategische Tiefe und überzeugende Erzählweise zu erreichen, bedarf es menschlicher Kontrolle, kritischer Überprüfung und Verfeinerung. Benutzer müssen bereit sein, das Tool aktiv zu nutzen, möglicherweise Eingaben und Ergebnisse zu iterieren und schließlich die Verantwortung für den endgültigen Inhalt des Angebots zu übernehmen. Die größte Stärke liegt in der Optimierung des Prozesses in Schritt 1; für den umfassenden Geschäftsplan in Schritt 2 und die entscheidende Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch in Schritt 3 ist wahrscheinlich erheblicher zusätzlicher Aufwand erforderlich, möglicherweise unter Einbeziehung von Beratung oder umfassender interner Expertise.
Abschließende Bewertung
ChatEIC stellt eine bemerkenswerte Weiterentwicklung des Toolkits für EIC Accelerator-Antragsteller dar. Durch die Kombination generativer KI-Funktionen mit Fachwissen über die komplexen Anforderungen des EIC bietet es eine potenziell wertvolle Ressource zur Effizienzsteigerung und Minimierung von Compliance-Risiken, insbesondere während der anspruchsvollen Einreichungsphase von Schritt 1. Der spezifische Fokus auf den EIC Accelerator verschafft ihm einen deutlichen Vorteil gegenüber generischen KI-Schreibtools für diese spezielle Aufgabe. Für Teams, die ihre Vorbereitung auf Schritt 1 beschleunigen, Kosten senken und die Übereinstimmung ihres Antrags mit den Erwartungen des EIC verbessern möchten, ist ChatEIC eine ernsthafte Überlegung im Rahmen ihrer Bewerbungsstrategie. Es ist ein Tool, das die bürokratischen Aspekte des Prozesses erleichtert und wertvolle Personalressourcen freisetzt, um sich auf die Kerninnovation und die strategische Vision zu konzentrieren, die für die Erreichung der Ziele unerlässlich sind. KI für EIC Accelerator-Erfolg.
Zuschuss des Innovationsfonds der Europäischen Kommission
EU-Innovationsfonds 2025–2026: Antragsleitfaden, Fristen & Erfolgstipps
Der EU-Innovationsfonds ist eines der weltweit größten Förderprogramme für innovative, saubere Technologien und zielt darauf ab, Netto-Null-Lösungen in großem Maßstab auf den Markt zu bringen. Finanziert durch Einnahmen aus dem EU-Emissionshandelssystem (ETS) unterstützt er innovative Projekte, die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren und Europa helfen, Klimaneutralität zu erreichen. Dieser Überblick erklärt, was der Innovationsfonds ist, wer sich bewerben kann, wie der Bewerbungsprozess abläuft und bietet Orientierungshilfe – von wichtigen Fristen 2025 und 2026 bis hin zu Tipps für die Erstellung eines überzeugenden Innovationsfondsantrags. Egal, ob Sie sich selbst bewerben oder einen Berater oder Antragssteller beauftragen, diese Einblicke helfen Ihnen, den Prozess zu meistern und Ihre Erfolgschancen zu verbessern.
Was ist der EU-Innovationsfonds?
Der EU-Innovationsfonds vergibt großzügige Zuschüsse für die Einführung innovativer Netto-Null-Technologien im industriellen Maßstab und wird durch das EU-EHS finanziert. Der Innovationsfonds ist ein klimaorientiertes Finanzierungsprogramm der Europäischen Kommission (GD CLIMA) zur Finanzierung der Demonstration und Skalierung innovativer kohlenstoffarmer Technologien. Es tritt die Nachfolge des früheren Programms NER300 an und soll bis 2030 rund 38 Milliarden Euro für zukunftsweisende Dekarbonisierungsprojekte bereitstellen. Anders als herkömmliche F&E-Fördermittel (z. B. Horizont Europa) dient der Innovationsfonds nicht der Grundlagenforschung, sondern zielt auf Projekte in der Pilot-, Demonstrations- oder ersten industriellen Einsatzphase ab und schließt so die Lücke zur kommerziellen Rentabilität. Indem er bis zu 60% der relevanten Projektkosten übernimmt (mit Zuschüssen in Höhe von Millionen bis Hunderten Millionen Euro), hilft er Unternehmen, hohe Vorlaufkosten und Risiken zu überwinden und ermöglicht ihnen, innovative Klimalösungen schneller auf den Markt zu bringen.
- Zweck: Ziel des Fonds ist es, deutliche Treibhausgasreduktionen (THG) in schwer reduzierbaren Sektoren voranzutreiben und gleichzeitig die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Er unterstützt Projekte in Bereichen wie erneuerbare Energien, Energiespeicherung, energieintensiven Industrien (wie Stahl, Zement, Chemie), Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS), Wasserstoff, nachhaltigen Kraftstoffen und anderen bahnbrechenden sauberen Technologien. Durch Investitionen in diese einzigartigen Projekte will der Innovationsfonds den Weg zu einem klimaneutralen Europa bis 2050 ebnen, im Einklang mit dem europäischen Green Deal und dem Net-Zero Industry Act. Erfolgreiche Projekte werden voraussichtlich über einen Zeitraum von zehn Jahren eine erhebliche CO₂-Reduktion erzielen und als wegweisend gelten, der in ganz Europa repliziert werden kann.
- Skala: Der Innovationsfonds führt von 2020 bis 2030 jährliche Ausschreibungen durch, die durch die Versteigerung von EU-EHS-Zertifikaten finanziert werden. Jede Ausschreibung stellt Milliarden von Euro zur Verfügung. Die Ausschreibung 2024/25 (für den Zyklus 2025) beispielsweise bietet Zuschüsse in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro – 2,4 Milliarden Euro für eine umfassende Ausschreibung zu Netto-Null-Technologien und 1 Milliarde Euro für eine spezielle Ausschreibung zur Batterieherstellung. Darüber hinaus hat der Fonds wettbewerbliche Wasserstoffauktionen (im Rahmen der Europäischen Wasserstoffbank) eingeführt, um die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zu unterstützen. Das Ausmaß der Förderung ist enorm: Bei einer kürzlich durchgeführten Ausschreibung für 2023 wurden 77 Projekte in 18 Ländern mit 4,2 Milliarden Euro gefördert, wobei für Vorzeigeprojekte Einzelzuschüsse von bis zu 262 Millionen Euro gewährt wurden. Diese Größenordnung macht den Innovationsfonds zu einer äußerst attraktiven Gelegenheit für Unternehmen mit mutigen Klimainnovationsprojekten.
Wer kann sich bewerben und welche Projekte sind förderfähig?
- Berechtigte Antragsteller: Grundsätzlich kann jede juristische Person – ob Privatunternehmen, öffentliche Einrichtung oder Konsortium, ob klein oder groß – Unterstützung aus dem Innovationsfonds beantragen, sofern sie in einem förderfähigen Land registriert ist. Zu den förderfähigen Ländern zählen alle EU-Mitgliedstaaten sowie die am EU-EHS teilnehmenden Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit Norwegen, Island und Liechtenstein). Antragsteller können sich einzeln (als einzelnes Unternehmen oder Organisation) oder als Konsortium mehrerer Partner bewerben. Im Gegensatz zu einigen EU-Programmen ist ein Konsortium nicht zwingend erforderlich; ein einzelnes Unternehmen kann einen Antrag auch allein einreichen. Alle Projekte müssen jedoch in den förderfähigen Ländern durchgeführt werden (d. h. der Projektstandort und die Projektwirkung müssen innerhalb der EU/des EWR liegen).
- Förderfähige Projekte: Der Innovationsfonds fördert eine breite Palette von Projekttypen, die jedoch alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: innovative Technologien mit erheblichen Klimaauswirkungen, die für die Skalierung bereit sind. Zu den wichtigsten Merkmalen förderfähiger Projekte gehören:
- Klimaauswirkungen: Das Projekt sollte die Treibhausgasemissionen in einem der förderfähigen Sektoren deutlich reduzieren. Zu diesen Sektoren gehören erneuerbare Energien (z. B. Solar- und Windenergie der nächsten Generation, erneuerbarer Wasserstoff), Energiespeicherung, energieintensive Industrien (z. B. kohlenstoffarme Stahl-, Zement- und Chemieprozesse), Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, alternative Kraftstoffe, Netto-Null-Mobilität und sogar klimafreundliche Gebäudetechnologien. Die erwartete Vermeidung von CO₂-Emissionen (oder Äquivalenten) über 10 Jahre ist ein entscheidender Faktor – Projekte müssen quantifizieren, wie viele Emissionen sie im Vergleich zu konventionellen Technologien vermeiden werden.
- Innovative Technologie: Projekte müssen einen hohen Innovationsgrad aufweisen. Typischerweise handelt es sich dabei um eine neuartige oder neue Technologie im industriellen Maßstab, die noch nicht kommerziell verfügbar ist. In Bezug auf den Technologiereifegrad (TRL) strebt der Innovationsfonds in der Regel einen Technologiereifegrad von etwa TRL 8 an – d. h. eine Technologie, die sich im Pilotmaßstab bewährt hat und nun erstmals kommerziell demonstriert wird. Reine Forschungs- oder Laborprojekte (TRL 6–7 oder darunter) werden nicht gefördert. Stattdessen sollte das Projekt kurz vor der Kommerzialisierung stehen und eine bahnbrechende Lösung in einer realen Betriebsumgebung demonstrieren. Dieser Fokus stellt sicher, dass der Fonds innovative Projekte unterstützt, die neue Technologien einsetzen, und nicht Forschungsprojekte oder bereits vollständig kommerzielle Lösungen.
- Reife und Lebensfähigkeit: Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Planung, Geschäftsmodell und Finanzstruktur ausreichend ausgereift sind. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung über ein gut entwickeltes Projekt verfügen sollten: Machbarkeitsstudien, ein Businessplan, technische Pläne und idealerweise wichtige Genehmigungen in Bearbeitung. Die EU erwartet von einem Innovationsfondsprojekt Investitionsreife – also eine Vorlage, die Sie Investoren oder dem Vorstand Ihres Unternehmens zur endgültigen Investitionsentscheidung vorlegen können. Ideen im Frühstadium ohne konkrete Umsetzungspläne werden voraussichtlich abgelehnt. Darüber hinaus darf die Projektumsetzung vor Antragstellung noch nicht begonnen haben – d. h. der Bau darf noch nicht im Gange sein und es dürfen noch keine unwiderruflichen Verträge unterzeichnet sein. (Vorbereitende Schritte wie die Sicherung von Grundstücken oder vorläufige Genehmigungen sind ausreichend.)
- Projektgröße: Der Fonds fördert sowohl große als auch kleine Projekte, die jedoch möglicherweise über unterschiedliche Ausschreibungen oder Förderprogramme bearbeitet werden. Historisch wurden „große“ Projekte als Projekte mit Investitionsausgaben über 7,5 Millionen Euro und „kleine“ Projekte als Projekte unter 7,5 Millionen Euro definiert. In jüngsten Ausschreibungen hat die Kommission die Projektgrößen weiter geschichtet – beispielsweise wurde die Ausschreibung 2024/25 so strukturiert, dass große Projekte (CAPEX über 100 Millionen Euro), mittlere Projekte (20–100 Millionen Euro) und kleine Projekte (2,5–20 Millionen Euro) in separaten Kategorien berücksichtigt wurden. Auch Pilotprojekte (hochinnovativ, aber noch nicht im richtigen Maßstab erprobt) erhalten einen besonderen Schwerpunkt. Dies bedeutet, dass Projekte unterschiedlicher Größenordnungen miteinander konkurrieren können – ob Sie eine Pilotanlage für 10 Millionen Euro oder eine kommerzielle Anlage für 200 Millionen Euro planen, es gibt einen Bewerbungsweg. Bedenken Sie jedoch: Je größer die Klimaauswirkungen (und der Finanzierungsbedarf), desto härter die Konkurrenz.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass förderfähige Projekte solche sind, die eine überzeugende, innovative Lösung zur Emissionsreduzierung in Europa darstellen, mit einem gut ausgearbeiteten Plan ausgestattet sind und in einem förderfähigen Land angesiedelt sind. Wenn Ihr Projekt diese Kriterien erfüllt, können Sie einen Antrag auf Förderung des Innovationsfonds stellen.
So bewerben Sie sich: Der Antragsprozess für den Innovationsfonds
- Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen: Um Fördermittel zu beantragen, müssen Projektträger eine offene Ausschreibung des Innovationsfonds beantragen. Ausschreibungen werden in der Regel jährlich (meist im Spätherbst oder Winter) auf der Website der Europäischen Kommission und dem EU-Portal „Funding & Tenders“ veröffentlicht. Die Ausschreibung für den Zyklus 2025 wurde beispielsweise am 3. Dezember 2024 eröffnet. Alle Bewerbungsunterlagen werden elektronisch über das EU-Portal „Funding & Tenders“ eingereicht – eine Einreichung per Post oder E-Mail ist nicht möglich. Potenzielle Antragsteller sollten zunächst ein EU-Login-Konto erstellen und ihre Organisation im Portal registrieren (falls noch nicht geschehen), um auf die Bewerbungsformulare zugreifen zu können.
- Einstufige Anwendung: Derzeit verwendet der Innovationsfonds für seine Hauptausschreibungen ein einstufiges Antragsverfahren. Dies bedeutet, dass Antragsteller in einem Rutsch einen vollständigen Projektvorschlag vorbereiten müssen (im Gegensatz zu einigen EU-Programmen, bei denen zunächst ein Konzeptpapier erstellt wird). Unterschätzen Sie den Aufwand nicht – ein vollständiger Antrag für den Innovationsfonds kann einschließlich technischer Anhänge 200 bis 300 Seiten umfassen. Sie müssen detaillierte Antragsformulare ausfüllen und zahlreiche Dokumente hochladen: eine Projektbeschreibung, einen Geschäftsplan, ein Finanzmodell, einen Umsetzungsplan, Berechnungen der Treibhausgasemissionen (THG) und mehr. Der Antrag erfordert eine gründliche Analyse – Sie müssen beispielsweise die Basis- und die prognostizierten Emissionen berechnen (mithilfe der von der EU bereitgestellten Methoden), eine Kostenanalyse durchführen und oft eine Lebenszyklusanalyse erstellen. Die Vorbereitung dieser Materialien kann mehrere Monate Arbeit eines multidisziplinären Teams in Anspruch nehmen. Es ist daher entscheidend, frühzeitig zu beginnen.
- Auswertung: Nach Ablauf der Einreichungsfrist werden alle Vorschläge einer gründlichen Prüfung ihrer Förderfähigkeit unterzogen und anschließend von unabhängigen, von der Europäischen Kommission ernannten Experten bewertet. Jeder förderfähige Vorschlag wird anhand von fünf zentralen Vergabekriterien bewertet:
- Vermeidung von Treibhausgasemissionen – Wie viele Emissionen werden durch das Projekt vermieden oder reduziert? (Je höher und kostengünstiger die Einsparungen, desto besser.)
- Innovationsgrad – Wie neuartig und bahnbrechend ist die Technologie im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik?
- Projektreife – Wie weit ist das Projekt hinsichtlich Planung, Genehmigung, Finanzierung und Umsetzungsbereitschaft fortgeschritten?
- Skalierbarkeit/Replizierbarkeit – Kann die Lösung skaliert oder anderswo repliziert werden, um die Wirkung in der gesamten EU zu maximieren?
- Kosteneffizienz – Wie kosteneffizient ist das Projekt, gemessen als Höhe der beantragten Finanzierung pro vermiedener Tonne CO₂-Äquivalent? Projekte erhalten in jeder Kategorie Punkte. Nur Projekte, die die Mindestschwellenwerte in allen Kriterien erfüllen, werden für eine Förderung berücksichtigt. Anschließend werden die Vorschläge mit der höchsten Punktzahl ausgewählt, bis das Budget der Ausschreibung ausgeschöpft ist. Die Auswahl erfolgt technologie- und geografieneutral: Es gibt keine festgelegten Quoten nach Sektor oder Land – die Qualität eines Vorschlags wird ausschließlich anhand dieser Kriterien beurteilt. Das sorgt für einen intensiven Wettbewerb. (Beispielsweise gingen für die Ausschreibung 2023 337 Bewerbungen aus ganz Europa ein, von denen nur 85 Projekte für eine Förderung vorselektiert wurden.) Nach der Auswertung wird typischerweise eine Rangliste der Gewinnerprojekte bekannt gegeben (normalerweise gegen Ende des Jahres). Projekte, die hoch bewertet, aber (aufgrund von Budgetbeschränkungen) nicht gefördert wurden, können auf eine Reserveliste gesetzt werden – manchmal, wenn andere ihre Bewerbung zurückziehen, bekommen Reserveprojekte eine Chance, wie es 2024 der Fall war. Alle Bewerber erhalten eine Rückmeldung. Qualitativ hochwertige Vorschläge, die keine Finanzierung erhalten haben, erhalten als Anerkennung zudem ein „Seal of Excellence“ (STEP), das bei der Suche nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten hilfreich sein kann.
- Zeitleiste von der Bewerbung bis zur Bewilligung: Der Prozess von der Einreichung bis zum Erhalt der Mittel ist langwierig. Für die Ausschreibung 2025 beispielsweise war der Stichtag der 24. April 2025. Ergebnisse werden bis zum vierten Quartal 2025 erwartet, die Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarungen bis zum ersten Quartal 2026. Mit anderen Worten vergehen zwischen der Frist und der Finanzhilfevereinbarung etwa 8–10 Monate. Insgesamt kann von dem Zeitpunkt, an dem Sie mit der Vorbereitung Ihres Antrags beginnen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr gefördertes Projekt tatsächlich starten können, weit über ein Jahr vergehen. Laut der EU liegen die Evaluierungsergebnisse für Einreichungen im Frühjahr im Spätherbst vor. Im Falle einer Auswahl unterzeichnen Sie einige Monate später eine Finanzhilfevereinbarung. Projekte haben dann bis zu vier Jahre Zeit, um die Finanzierung abzuschließen und mit der Umsetzung zu beginnen. Antragsteller sollten daher eine lange Vorlaufzeit einplanen und sicherstellen, dass der Zeitplan ihres Projekts dies berücksichtigt.
- Bewerbungstipps: Lesen Sie die offiziellen Ausschreibungsunterlagen und Hinweise auf dem Funding & Tenders-Portal sorgfältig durch. Die Europäische Kommission stellt in der Regel detaillierte Anleitungen, Vorlagen und sogar Webinare oder Infotage für Antragsteller bereit (beispielsweise fand im Dezember 2024 ein Infotag für die IF24-Ausschreibung statt). Nutzen Sie die Fragen-und-Antwort-Runde, falls Unklarheiten bestehen. Und wichtig: Reichen Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig ein – das Portal schließt pünktlich zum Stichtag (in der Regel um 17:00 Uhr MEZ am Stichtag), und verspätete Einreichungen werden nicht akzeptiert. Es ist ratsam, Ihre Dateien einige Tage früher hochzuladen, um technische Probleme in letzter Minute zu vermeiden.
Zusammenarbeit mit einem Berater oder Autor für Innovationsfonds
Die Vorbereitung eines erfolgreichen Antrags auf einen Innovationsfonds ist eine komplexe und ressourcenintensive Aufgabe. Viele Unternehmen engagieren einen Berater oder Antragsschreiber für Innovationsfonds, um ihre Erfolgschancen zu verbessern. Sollten Sie die Beauftragung eines solchen Beraters in Erwägung ziehen? So kann ein kompetenter Berater oder Antragsschreiber einen Mehrwert schaffen:
- Strategische Beratung und Machbarkeitsprüfung: Erfahrene Berater für Innovationsfonds prüfen zunächst, ob Ihr Projekt zu den Zielen und Kriterien des Fonds passt. Sie führen häufig eine Machbarkeitsprüfung oder Projektbewertung durch, um die Stärken und Schwächen des Projekts im Vergleich zur Konkurrenz zu beurteilen. Befindet sich Ihr Projektkonzept noch in einem frühen Stadium oder fehlen wichtige Elemente, kann ein Berater Ihnen raten, ob Sie es jetzt umsetzen oder es gegebenenfalls überarbeiten und sich bei einer späteren Ausschreibung bewerben sollten (eine Go/No-Go-Empfehlung). So sparen Sie sich den Aufwand für einen Antrag, der noch nicht fertig ist.
- Ausrichtung des Projekts an den Finanzierungskriterien: Ein Berater bringt Fachwissen zu den Bewertungskriterien des Innovationsfonds und den politischen Prioritäten der EU mit. Er kann Ihnen helfen, den Umfang Ihres Projekts so zu gestalten, dass er den Erwartungen der Gutachter entspricht – und dafür sorgen, dass Sie die punktebringenden Aspekte hervorheben. Beispielsweise kann er Sie bei der Berechnung der Treibhausgasemissionsvermeidung mit der richtigen Methodik unterstützen oder Ihnen Möglichkeiten vorschlagen, den Beitrag Ihres Projekts zu den EU-Klimazielen und dem Green Deal hervorzuheben. Er stellt sicher, dass Ihre Projektbeschreibung jedes der fünf Kriterien (Innovation, Wirkung, Reife, Skalierbarkeit, Kosten) überzeugend berücksichtigt.
- Verfassen und Dokumentieren von Vorschlägen: Einen klaren und überzeugenden Antrag zu verfassen, ist eine Kunst. Die Autoren von Innovationsfonds sind darin geübt, komplexe technische Projekte so zu formulieren, dass sie die Gutachter überzeugen. Sie können die Antragsunterlagen federführend verfassen oder Ihre Entwürfe durch umfangreiches Lektorat und Feedback verfeinern. Sie achten auf eine klare Sprache, eine gute Erläuterung der Ziele und Auswirkungen sowie die Bereitstellung aller erforderlichen Details und Anhänge. Ein guter Fördermittelautor hilft Ihnen außerdem, häufige Fehler zu vermeiden – wie etwa Unstimmigkeiten zwischen dem technischen und finanziellen Teil oder fehlende Informationen, die Punkte kosten könnten.
- Projektmanagement der Anwendung: Da ein Antrag auf einen Innovationsfonds aus vielen Teilen besteht (technischer Plan, Finanzmodell, Umweltanalyse usw.), fungieren Berater häufig als Projektmanager für den Antragsprozess. Sie legen Zeitpläne fest, koordinieren die Beiträge verschiedener Abteilungen oder Partner und prüfen, ob alle Formulare korrekt ausgefüllt sind. Sie stellen außerdem sicher, dass die endgültige Einreichung vollständig und fristgerecht erfolgt und laden alles rechtzeitig vor Ablauf der Frist in das Portal hoch.
- Expertise aus vergangenen Erfolgen: Erfahrene Berater für Innovationsfonds haben in der Regel bereits an mehreren Anträgen mitgewirkt und wissen, wie ein erfolgreicher Antrag aussieht. Viele sind Ingenieure oder Finanzexperten, die Ihre Daten validieren oder Ihren Business Case untermauern können. Sie können beispielsweise Ihre Kostenannahmen überprüfen oder Verbesserungen für Ihren Risikominderungsplan vorschlagen. Einige Beratungsunternehmen bieten im Erfolgsfall sogar Unterstützung bei der Verhandlung von Fördervereinbarungen an. Diese umfassende Unterstützung kann von unschätzbarem Wert sein, insbesondere für Erstantragsteller oder kleinere Unternehmen mit begrenzten internen Antragskapazitäten.
Lohnt sich das? Die Beauftragung eines Beraters verursacht zwar zusätzliche Kosten, kann aber die Qualität und Erfolgschancen Ihres Antrags deutlich steigern. Angesichts der Höhe der Fördermittel (möglicherweise mehrere zehn Millionen Euro) zahlt sich die Investition in professionelle Unterstützung oft aus. In früheren Förderrunden des Innovationsfonds standen viele erfolgreiche Projekte in der Verantwortung von erfahrenen Beratern oder Autoren. Beispielsweise haben regionale Agenturen lokalen Unternehmen bei der Finanzierung geholfen – zwei bayerische Cleantech-Projekte erhielten mit Unterstützung Zuschüsse in Höhe von 91 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds. Auch mehrere der 85 für die Ausschreibung 2023 ausgewählten Projekte wurden mithilfe spezialisierter Beratungsunternehmen vorbereitet. Diese Experten können den Prozess effizienter steuern und Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden, die ein ansonsten gutes Projekt gefährden könnten.
Natürlich ist die Beauftragung eines Beraters nicht zwingend erforderlich – viele Organisationen erstellen erfolgreiche Anträge intern, insbesondere wenn sie über starke Teams für die Antragstellung verfügen. Wenn Sie jedoch neu in der EU-Förderung sind oder die internen Ressourcen fehlen, ist die Beauftragung eines Beraters oder Antragsschreibers für Innovationsfonds eine sinnvolle Überlegung. Zumindest sollten Sie Ihren Antrag vor der Einreichung extern prüfen lassen, um objektives Feedback zu erhalten.
- Auswahl eines Beraters: Wenn Sie externe Hilfe in Anspruch nehmen, suchen Sie nach Unternehmen oder Einzelpersonen mit Erfahrung im Innovationsfonds oder ähnlichen EU-Klima-/Innovationsprogrammen. Fragen Sie nach deren Erfolgsquote und stellen Sie sicher, dass sie die technischen Aspekte Ihres Projekts verstehen. Klare Vereinbarungen über den Umfang (z. B. Schreiben vs. Beraten) und Vertraulichkeit sind wichtig. Letztendlich liegt der Vorschlag bei Ihnen – ein Berater kann jedoch ein wertvoller Partner bei der Gestaltung und Kommunikation Ihrer Vision sein.
Wichtige Fristen und Ausschreibungen für den Innovationsfonds für 2025 und 2026
Bei der Planung Ihres Innovationsfondsantrags ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Termine und Fristen für die Ausschreibung 2025 sowie die Erwartungen für 2026:
- Ausschreibung 2025 (IF24): Die Hauptausschreibung des Innovationsfonds für den sogenannten Zyklus 2025 begann am 3. Dezember 2024, und die Frist zur Einreichung von Anträgen war der 24. April 2025. Diese oft als IF24 bezeichnete Ausschreibung umfasst eigentlich mehrere Bereiche: eine allgemeine Ausschreibung für Netto-Null-Technologien (Budget 2,4 Milliarden Euro) und eine Ausschreibung für die Batterieherstellung (1 Milliarde Euro), die gleichzeitig starteten. Beide hatten dieselbe Frist, den 24. April 2025. Parallel dazu wurde am 3. Dezember 2024 die zweite Wasserstoffauktion (für grüne Wasserstoffprojekte im Rahmen der Europäischen Wasserstoffbank) mit einer Einreichungsfrist am 20. Februar 2025 gestartet. Potenzielle Antragsteller mussten ihre vollständigen Anträge bis zu diesen Terminen über das EU-Portal einreichen. Nach der Einreichung werden die Bewertungsergebnisse Ende 2025 erwartet (die Kommission hat das vierte Quartal 2025 angegeben) und die Zuschussvergabe sollte bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass erfolgreiche Projekte aus der Ausschreibung 2025 wahrscheinlich Anfang 2026 starten können.
- 2026 Call (voraussichtlich IF25): Die Europäische Kommission startet üblicherweise jedes Jahr im Dezember eine neue Ausschreibung für den Innovationsfonds. Diesem Muster folgend wird die Ausschreibung für die Finanzierung 2026 voraussichtlich im Dezember 2025 veröffentlicht. Offizielle Details werden zwar Ende 2025 bekannt gegeben, Antragsteller können jedoch mit einer ähnlichen Struktur rechnen – möglicherweise einer großen allgemeinen Ausschreibung (möglicherweise mit Schwerpunkt auf vorrangigen Bereichen, die mit der EU-Klimapolitik im Einklang stehen) und vielleicht spezialisierten Ausschreibungen oder Auktionen (z. B. Wasserstoff), während die Kommission ihre Finanzierungsstrategie fortsetzt. Die Einreichungsfrist ist voraussichtlich im Frühjahr 2026, möglicherweise um April 2026 (indikativ). Wenn die Ausschreibung beispielsweise Mitte Dezember 2025 beginnt, könnte die Frist nach einem etwa viermonatigen Bewerbungszeitraum im April 2026 liegen. Das genaue Datum finden Sie immer in der offiziellen Bekanntmachung – es wird auf der EU-Website für Klimaschutz und dem Portal „Finanzierung und Ausschreibungen“ veröffentlicht. Zum jetzigen Zeitpunkt (Mai 2025) erwarten wir, dass der Zeitplan für die Ausschreibung 2026 dem der vorherigen Runden entspricht: Start im Dezember 2025, Frist etwa im April 2026, Ergebnisse bis Ende 2026 und unterzeichnete Zuschüsse bis Anfang 2027.
- Zukünftige Ausschreibungen: Der Innovationsfonds wird über 2026 hinaus mit jährlichen Ausschreibungen bis 2030 fortgeführt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von ETS-Einnahmen. Die jährliche Ausschreibung kann unterschiedliche Schwerpunkte oder spezielle Budgets haben (die Kommission hat die Ausschreibungen an Initiativen wie den Net-Zero Industry Act und REPowerEU angepasst). Sollte Ihr Projekt also nicht rechtzeitig für 2025 oder 2026 fertig sein, können Sie sich auf spätere Ausschreibungen bewerben. Beachten Sie jedoch, dass der Wettbewerb mit der zunehmenden Popularität des Fonds zunimmt. Es ist wichtig, sich über die neuesten Themen und Anforderungen der Ausschreibungen auf dem Laufenden zu halten (melden Sie sich für den EU-Klimaschutz-Newsletter an oder besuchen Sie regelmäßig die Website).
Fristen sind absolut. Verpasst man eine Frist, muss man auf die nächste Ausschreibung warten (in der Regel ein Jahr später). Sobald die Ausschreibungstermine bekannt gegeben wurden, sollten Sie daher Ihre Antragsvorbereitung rückwärts planen. Viele erfolgreiche Bewerber beginnen bereits Monate vor der Ausschreibung mit der Ausarbeitung ihrer Anträge. Um beispielsweise eine Frist im April einzuhalten, ist es ratsam, spätestens im Herbst des Vorjahres mit den ernsthaften Vorbereitungen zu beginnen. Manche beginnen sogar schon ein Jahr früher mit der Datenerfassung, insbesondere bei komplexen Ingenieurprojekten.
Behalten Sie auch nach Ablauf der Bewerbungsfristen die Unterstützungsaktivitäten rund um die Ausschreibungen im Auge. Die Kommission und CINEA (die für die Umsetzung des Fonds zuständige Agentur) veranstalten häufig einige Wochen nach Beginn einer Ausschreibung Infotage, Webinare und Orientierungsgespräche für Antragsteller, bei denen Sie Fragen stellen und Unklarheiten klären können. Diese Veranstaltungen finden typischerweise im Dezember oder Januar statt, wenn die Ausschreibung im Frühjahr endet. Sie werden auf der Website des Innovationsfonds angekündigt und die Teilnahme ist in der Regel kostenlos. Wenn Sie diese Veranstaltungen nutzen, erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Anforderungen der Gutachter und in neue Elemente einer bestimmten Ausschreibung.
Best Practices für einen überzeugenden Innovationsfonds-Vorschlag
Die Beantragung einer Förderung durch den Innovationsfonds ist eine Herausforderung – mit dem richtigen Ansatz können Sie die Erfolgschancen Ihres Antrags jedoch deutlich verbessern. Hier finden Sie einige Best Practices und Erfolgstipps für die Erstellung eines erfolgreichen Innovationsfondsantrags:
- Beginnen Sie früh und planen Sie gründlich: Wie bereits erwähnt, ist die Antragstellung ein umfangreiches Unterfangen (Hunderte von Seiten Dokumentation) und erfordert viel Zeit. Beginnen Sie so früh wie möglich mit der Organisation Ihres Teams und der Aufgaben – idealerweise mindestens sechs Monate vor Ablauf der Frist. Teilen Sie die Arbeit auf: technisches Design, Emissionsberechnungen, Finanzmodellierung, Genehmigungen usw. Erstellen Sie einen Zeitplan mit internen Kontrollpunkten. So vermeiden Sie, dass Sie in letzter Minute ins Schleudern geraten. Tipp: Wenn die Ausschreibung noch nicht eröffnet ist, orientieren Sie sich an den Unterlagen der vorherigen Ausschreibung – die Anforderungen sind oft ähnlich, und Sie können bereits im Voraus einen Entwurf erstellen.
- Verstehen Sie die Bewertungskriterien und passen Sie Ihren Vorschlag entsprechend an: Richten Sie jeden Abschnitt Ihres Vorschlags an den fünf Kriterien (Treibhausgasauswirkungen, Innovation, Reife, Skalierbarkeit, Kosten) aus. Machen Sie es den Gutachtern leicht, Ihre Leistungen in den einzelnen Bereichen zu erkennen. Reservieren Sie beispielsweise einen Abschnitt zur Quantifizierung Ihrer Treibhausgasvermeidung (mit klaren Berechnungen und Verweisen auf die bereitgestellte Methodik) und heben Sie die Zahl hervor (z. B. „Unser Projekt wird bis 2030 jährlich ca. XXX.000 Tonnen CO₂e einsparen“). Betonen Sie die Innovation Ihrer Technologie und wie sie sich vom Stand der Technik unterscheidet – denken Sie daran, dass nur Projekte finanziert werden, die im Vergleich zu aktuellen Lösungen wirklich neuartig sind. Demonstrieren Sie die Projektreife, indem Sie Genehmigungen, Abnahmevereinbarungen oder bestehende Partnerschaften sowie einen soliden Umsetzungsplan auflisten (der zeigt, dass das Projekt grundsätzlich entwicklungsreif ist, sofern die Finanzierung vorliegt). Erörtern Sie Skalierbarkeit/Replizierbarkeit – könnte dies beispielsweise auf zehn weitere Standorte ausgeweitet werden oder den Weg für den Wandel einer ganzen Branche ebnen? Legen Sie, falls verfügbar, Nachweise vor (Bewerbungsschreiben usw.). Achten Sie außerdem auf Kosteneffizienz: Die beantragte Fördersumme sollte durch die Klimaauswirkungen gerechtfertigt sein. Projekte werden in Euro pro vermiedener Tonne CO₂ bewertet. Wenn Ihre Kosten pro Tonne also hoch sind, begründen Sie dies (vielleicht handelt es sich um ein neuartiges Problem, das sich verbessern wird usw.) und zeigen Sie, dass Sie sich der Kosteneffizienz bewusst sind.
- Entwickeln Sie einen soliden Business Case: Behandeln Sie Ihren Innovationsfondsantrag wie einen Investitionsprospekt für ein neues Unternehmen. Die Gutachter möchten sehen, dass das Projekt nicht nur technisch, sondern auch finanziell und betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Fügen Sie einen ausführlichen Geschäftsplan und ein Finanzmodell bei – diese Anhänge sind obligatorisch. Zeigen Sie Ihre geplanten Investitions- und Betriebskosten, Ihre Einnahmen (falls vorhanden) und wie das Projekt langfristig rentabel sein wird. Sollte das Projekt ohne CO2-Bepreisung oder -Unterstützung wirtschaftlich nicht rentabel sein, seien Sie offen, aber erläutern Sie, wie es zum Lernen oder zu zukünftigen Kostensenkungen beiträgt. Heben Sie Kofinanzierungsquellen hervor: Denken Sie daran, dass der Fonds in der Regel bis zu 60% der zusätzlichen Kosten kofinanziert. Sie müssen daher nachweisen, woher die restlichen Investitionen kommen (z. B. Unternehmenskapital, Bankkredite, staatliche Zuschüsse). Eine klare Finanzierungsstrategie und Unterstützungsschreiben von Investoren oder Banken können die Reife und Glaubwürdigkeit Ihres Antrags deutlich stärken. Beschreiben Sie außerdem die Erfahrung Ihres Projektteams – zeigen Sie, dass das Konsortium oder Unternehmen über das Know-how verfügt, dieses Projekt umzusetzen.
- Heben Sie die Klimazusätzlichkeit hervor: Der Innovationsfonds zielt darauf ab, die Klimawirkung zu maximieren. Ihr Antrag sollte klar darlegen, warum das Projekt ohne die Förderung nicht umgesetzt werden könnte (oder deutlich weniger Klimanutzen hätte). Beispielsweise könnte die Technologie hohe Vorlaufkosten oder Risiken mit sich bringen, die der Markt derzeit nicht finanzieren kann – daher ist öffentliche Förderung erforderlich. Mit dieser Begründung sprechen Sie die grundlegende Mission des Fonds an. Verwenden Sie Daten: z. B.: „Ohne Förderung würde unser innovatives Zementwerk 201 t CO₂ einsparen; mit der Förderung des Innovationsfonds können wir eine Reduzierung von 901 t CO₂ erreichen und so zusätzlich 500.000 t CO₂ pro Jahr einsparen, die sonst weiterhin ausgestoßen würden.“
- Stellen Sie technische Solidität und Details sicher: Obwohl der Vorschlag keine wissenschaftliche Arbeit ist, muss er Experten von der wissenschaftlichen und technischen Glaubwürdigkeit Ihrer Technologie überzeugen. Geben Sie ausreichend Details zur Technologie (Design, Prozessablauf usw.) an, um zu zeigen, dass Sie sie beherrschen. Fügen Sie Ergebnisse aus Pilotversuchen oder Simulationen hinzu, um Ihre Leistungsaussagen zu untermauern. Wenn Sie ein neuartiges Verfahren verwenden, erwähnen Sie Patente, Veröffentlichungen oder Expertenempfehlungen. Halten Sie die Erklärungen gleichzeitig verständlich – Gutachter sind möglicherweise keine Spezialisten in Ihrer Nische. Erläutern Sie daher alle Fachbegriffe und Konzepte. Verwenden Sie Diagramme oder Tabellen (Anhänge sind in der Bewerbung zulässig), um das Projektdesign und die Zeitpläne zu veranschaulichen – ein Bild kann einen komplexen Prozess viel schneller vermitteln als Text.
- Quantifizieren Sie alles, was Sie können: Legen Sie nach Möglichkeit quantitative Belege vor. Ziele, Kennzahlen und Zahlen machen Ihren Vorschlag überzeugender. Verwenden Sie für Emissionen die offizielle Berechnungsmethode und geben Sie die gesamten vermiedenen Treibhausgasemissionen über 10 Jahre klar an. Quantifizieren Sie im Hinblick auf Innovationen beispielsweise Effizienzgewinne (z. B. „50% weniger Energieverbrauch als der Stand der Technik“) oder andere Leistungsverbesserungen. Beschreiben Sie im Hinblick auf Skalierbarkeit ein mögliches Replikationsszenario (z. B. „Bei Anwendung auf alle Stahlwerke in Europa könnte diese Technologie jährlich X Millionen Tonnen CO₂ einsparen“). Konkrete Zahlen bleiben den Gutachtern im Gedächtnis und verleihen Glaubwürdigkeit (achten Sie jedoch darauf, dass sie realistisch sind und über Belege verfügen).
- Seien Sie klar und präzise: Ein klarer und verständlicher Text ist entscheidend. Gutachter müssen Hunderte von Seiten lesen. Erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie strukturiert und prägnant schreiben. Verwenden Sie Überschriften und Unterüberschriften, die den Bewertungskriterien oder der im Antragsformular geforderten Struktur entsprechen. Fassen Sie wichtige Informationen in Aufzählungspunkten oder Tabellen zusammen (z. B. eine Tabelle mit Treibhausgasberechnungen oder eine Zeitleiste mit Meilensteinen). Vermeiden Sie unnötigen Fachjargon und geben Sie bei Bedarf eine kurze Erklärung ab. Denken Sie daran: Ihr Vorschlag ist im Wesentlichen ein Pitch – er sollte eine überzeugende Geschichte von Innovation und Wirkung erzählen und mit Belegen untermauern. Viele Unternehmen beauftragen einen Autor des Innovationsfonds oder lassen den Text zumindest von mehreren Gutachtern auf Kohärenz und Grammatik überprüfen. Schlechter Schreibstil kann großartige Ideen verschleiern. Planen Sie daher Zeit für Korrekturlesen und die Verfeinerung des Textes ein.
- Sprechen Sie potenzielle Risiken offen an: Jedes innovative Projekt birgt Risiken – technische Ausfälle, Kostenüberschreitungen, regulatorische Hürden usw. In der Bewerbung wird üblicherweise eine Risikobewertung verlangt. Scheuen Sie sich nicht davor, sondern legen Sie stattdessen einen durchdachten Plan zur Risikominderung vor. Die Identifizierung von Risiken und die Bereitstellung von Lösungen (Notfallpläne, zusätzlicher Supportbedarf, schrittweises Vorgehen usw.) zeigen den Gutachtern, dass Sie realistisch und vorbereitet sind, und unterstreichen so die Projektreife.
- Verwenden Sie die bereitgestellten Ressourcen und Vorlagen: Die Europäische Kommission stellt Leitfäden, FAQs und Vorlagen zur Verfügung – um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Nutzen Sie die offizielle Antragsvorlage als Gliederung und füllen Sie alle Abschnitte aus. In den FAQ oder im Helpdesk der Kommission finden Sie weitere Informationen zum Umfang oder den Regeln (z. B. zur Förderfähigkeit bestimmter Kosten). Darüber hinaus können die Beschreibungen früherer Projekte des Innovationsfonds (verfügbar auf der offiziellen Website) Aufschluss darüber geben, wie erfolgreiche Projekte aussehen. Zusammenfassungen geförderter Projekte sind hilfreich, um deren Innovationsgrad und Wirkung einzuschätzen.
- Erwägen Sie eine externe Überprüfung oder Unterstützung: Vor der Einreichung ist es äußerst hilfreich, Ihren Vorschlag von jemandem, der nicht direkt am Schreiben beteiligt ist, kritisch prüfen zu lassen. Dies könnte ein interner Kollege aus einem anderen Team oder ein externer Berater sein, falls Sie einen beauftragt haben. Diese könnten Auslassungen oder Unklarheiten entdecken. Führen Sie nach Möglichkeit eine Probebewertung durch – bewerten Sie Ihren Vorschlag ehrlich anhand der fünf Kriterien, um mögliche Schwächen zu erkennen und diese dann zu verbessern. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, kann ein Berater oder Autor des Innovation Funds kompetentes Feedback geben und sicherstellen, dass Ihr Vorschlag auf hohem Niveau ausgearbeitet ist, was Ihre Erfolgschancen erhöht.
Bis 2025 hat der Innovationsfonds bereits Dutzende innovativer Projekte finanziert (77 Projekte erhielten Fördermittel im Rahmen der Ausschreibung 2023, plus sechs weitere aus der Reserveliste). Dies zeigt, dass ambitionierte Anträge erfolgreich sein können. Lernen aus vergangenen Erfolgen kann Ihre eigene Antragsstrategie beeinflussen. Die Einhaltung dieser Best Practices wird dazu beitragen, dass Ihr Antrag für den Innovationsfonds im wettbewerblichen Bewertungsprozess hervorsticht. Ein überzeugender, gut vorbereiteter Antrag erzielt nicht nur bessere Ergebnisse, sondern stärkt auch das Vertrauen der Gutachter in die Fähigkeit Ihres Teams, das Projekt in der Praxis umzusetzen – ein entscheidender Aspekt für diesen Fonds.
Fazit: Vorbereitung auf den Erfolg des Innovationsfonds
Der EU-Innovationsfonds bietet Innovatoren im Bereich sauberer Technologien und Klimalösungen ab 2025, 2026 und darüber hinaus eine hervorragende Chance. Seine umfangreiche Finanzierung kann ehrgeizige Projekte verwirklichen und sowohl Ihr Unternehmenswachstum als auch Europas Weg zu Netto-Null-Emissionen beschleunigen. Um vom Innovationsfonds erfolgreich zu sein, müssen Sie proaktiv sein: Planen Sie vorausschauend, erstellen Sie einen überzeugenden Antrag und nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen – einschließlich der Möglichkeit, einen Berater oder Experten des Innovationsfonds hinzuzuziehen, um Ihren Antrag zu stärken.
Beachten Sie die wichtigsten Fristen (April 2025 und voraussichtlich Frühjahr 2026 für die kommenden Ausschreibungen) und verfolgen Sie die offiziellen EU-Kanäle hinsichtlich Aktualisierungen oder neuer Möglichkeiten. Der Prozess ist anspruchsvoll, aber die Belohnung ist hoch – nicht nur in Form von Finanzierung, sondern auch in Form von Prestige und Dynamik. Vom Innovationsfonds ausgewählte Projekte gelten als Vorreiter und ziehen oft zusätzliche Investoren, Partner und öffentliche Aufmerksamkeit an.
Kurz gesagt: Machen Sie Ihre Hausaufgaben, erzählen Sie eine überzeugende Geschichte mit soliden Daten und reichen Sie Ihre Bewerbung rechtzeitig ein. Viele Organisationen haben diesen Weg bereits beschritten und sich Fördermittel in Millionenhöhe gesichert, um ihre Träume von Klimainnovationen zu verwirklichen – mit sorgfältiger Vorbereitung könnte Ihr Projekt das nächste sein. Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung für den Innovationsfonds und auf Ihren potenziellen Erfolg in den Förderphasen 2025 und 2026!
Das Antragsformular für den EU-Innovationsfonds verstehen
Der Innovationsfonds der Europäischen Union (INNOVFUND) unterstützt innovative Projekte mit Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen Technologien. Die Beantragung dieser Förderung erfordert ein spezielles Antragsverfahren, das hauptsächlich über das EU-Förder- und Ausschreibungsportal läuft. Kernstück dieses Verfahrens ist das Antragsformular, ein umfassendes Dokument, das alle notwendigen administrativen und technischen Details eines vorgeschlagenen Projekts erfasst. Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick basierend auf der bereitgestellten Version 4.0 (Stand: 15. November 2024) der Standardvorlage für das INNOVFUND-Antragsformular. Wichtig zu beachten: Dieses Dokument dient als Beispiel und die tatsächlich auf dem Portal verfügbaren Formulare können abweichen.
Aufbau des Antragsformulars
Das Antragsformular gliedert sich in zwei Hauptteile:
- Teil A: Verwaltungsformulare: Dieser Abschnitt enthält strukturierte Verwaltungsinformationen zum Projekt und seinen Teilnehmern. Er wird automatisch vom IT-System auf Grundlage der vom Antragsteller direkt in die Formulare des Portal-Einreichungssystems eingegebenen Daten generiert.
- Teil B: Technische Beschreibung: Hierbei handelt es sich um eine narrative Beschreibung der technischen Aspekte des Projekts. Antragsteller müssen die Vorlage vom Portal herunterladen, ausfüllen und zusammen mit den erforderlichen Anhängen als PDF-Datei hochladen.
Teil A: Verwaltungsformulare – Wichtige Abschnitte
Teil A muss direkt online über das Portal ausgefüllt werden. Das bereitgestellte Dokument dient als Beispiel und muss nicht ausgefüllt werden. Es beschreibt die typischen Abschnitte:
- Allgemeine Informationen: Enthält die Ausschreibungskennung, das Thema, die Art der Maßnahme, Details zum Vorschlag (Akronym, Titel, Dauer), eine Zusammenfassung, Schlüsselwörter und Informationen zu früheren Einreichungen. Der Vorschlagstitel sollte auch für Laien verständlich sein.
- Teilnehmer: Listet alle am Projekt beteiligten Organisationen auf. Detaillierte Informationen zu jedem Teilnehmer sind erforderlich, einschließlich Name, Anschrift, Rechtsform (öffentliche Einrichtung, gemeinnützig, KMU-Status usw.) und Abteilungsdetails.
- Budget: Eine Übersicht über die beantragte Zuschusshöhe pro Begünstigtem.
- Andere Fragen: Dieser Abschnitt kann Einzelheiten zu den Standorten der Projektimplementierung und spezifische Berechnungen im Zusammenhang mit den Projektzielen enthalten, wie etwa die Vermeidung von Treibhausgasemissionen (THG) (absolut und relativ) und die Kosteneffizienz.
- Erklärungen: Der Antragsteller muss mehrere Erklärungen abgeben, in denen er bestätigt:
- Zustimmung aller Teilnehmer.
- Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
- Erfüllung der Förderkriterien, Fehlen von Ausschlussgründen und finanzielle/operative Leistungsfähigkeit.
- Bestätigung der Kommunikation über das Portal und Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung.
- Bei Pauschalzuschüssen ist zu bestätigen, dass das Budget den üblichen Kostenrechnungspraktiken entspricht und nicht förderfähige Kosten ausschließt.
- Verstehen Sie, dass falsche Angaben zu Verwaltungsstrafen führen können.
- Der Koordinator ist für seine Angaben verantwortlich, jeder Antragsteller für seine eigenen. Bei Förderung ist eine ehrenwörtliche Erklärung erforderlich.
Das System umfasst Validierungsprüfungen und zeigt Fehler (die die Übermittlung blockieren) oder Warnungen (die die Übermittlung nicht blockieren, sondern auf fehlende/falsche Werte hinweisen) an.
Teil B: Technische Beschreibung – Kernkomponenten
Teil B erfordert eine ausführliche Beschreibung und muss bestimmte Formatierungsregeln (z. B. Seitenbegrenzung, Schriftgröße, Ränder) einhalten. Bei Überschreitung der Seitenbegrenzung (in der Regel 70 Seiten, sofern nicht anders angegeben) werden die überzähligen Seiten nicht berücksichtigt. Für wichtige Informationen sollten keine Hyperlinks verwendet werden.
Zu den wichtigsten Abschnitten in Teil B gehören:
- Projekt und Antragsteller (Abschnitt 0): Bietet Hintergrundinformationen, Begründungen, Ziele, stellt die Konsortiumsmitglieder vor und skizziert die technischen Merkmale des Projekts (Standort, Technologie, Inputs, Outputs). Außerdem werden der Technologieumfang, die Konstruktion, der Betrieb, die Wartungspläne, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und die technische Leistung detailliert beschrieben. Für batteriebezogene Ausschreibungen sind spezifische Angaben zu Chemie und Leistung erforderlich.
- Innovationsgrad (Abschnitt 1): Beschreibt die Innovation des Projekts im Vergleich zum aktuellen kommerziellen und technologischen Stand der Technik, wobei der Schwerpunkt auf europäischen oder relevanten globalen Ebenen liegt. Es muss erläutert werden, wie das Projekt über inkrementelle Innovation hinausgeht. Dabei muss auf Daten aus dem Anhang zur Machbarkeitsstudie verwiesen und die erwartete Steigerung des Reifegrads sowie die zu überwindenden Hindernisse detailliert beschrieben werden.
- Potenzial zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen (Abschnitt 2): Erfordert die Berechnung des absoluten und relativen Treibhausgas-Emissionsvermeidungspotenzials über 10 Jahre nach Inbetriebnahme unter Verwendung der offiziellen Methodik und des Berechnungsmodells. Annahmen für Referenz- und Projektszenarien müssen erläutert werden. Die Ergebnisse müssen mit Teil C und der Kosteneffizienzberechnung übereinstimmen. Bei Projekten im Rahmen des EU-EHS müssen die Emissionen unter dem relevanten Benchmark liegen. Projekte, die Biomasse verwenden, müssen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Bei Batterieprojekten umfasst dieser Abschnitt den CO2-Fußabdruck der Herstellung, der jedoch ebenfalls separat bewertet wird.
- Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Fertigung (Abschnitt 3, n. z. für NZT-Aufruf): Ähnlich wie bei der Vermeidung von Treibhausgasen sind hierfür eine Bewertung und Berechnung unter Verwendung der angegebenen Methodik und Vorlage sowie detaillierte Annahmen erforderlich.
- Projektreife (Abschnitt 4): Bewertet die Projektbereitschaft in technischer, finanzieller und betrieblicher Hinsicht.
- Technische Reife: Nachweis der Technologiebereitschaft, der technischen Machbarkeit, der Risikobewertung und -minderung, unterstützt durch einen obligatorischen Anhang zur Machbarkeitsstudie und möglicherweise Due-Diligence-Berichte.
- Finanzielle Fälligkeit: Der Schwerpunkt liegt auf der Solidität des Geschäftsplans, der Finanzierungsstruktur und den Förderzusagen. Erforderlich sind Anhänge wie ein detaillierter Budget-/Kostenrechner, ein Geschäftsplan, ein Finanzmodell sowie gegebenenfalls Aktionärserklärungen und unterstützende Dokumente. Erforderlich sind Zusammenfassungen des Geschäftsvorschlags, Cashflow-Prognosen, Rentabilität (vor/nach Fördermittelbewilligung), Sensitivitätsanalyse, Finanzierungsplan und Förderzusagen.
- Betriebsreife: Demonstriert einen umfassenden und realistischen Implementierungsplan. Details umfassen den Implementierungszeitplan (Gantt-Diagramm erforderlich), wichtige Meilensteine (Finanzabschluss, Inbetriebnahme), Genehmigungsstrategie, Betriebsstrategie (Wartung, Kapazitäten), Projektmanagementteam (Qualifikationen, Fähigkeiten) und Projektorganisation (Struktur, Governance, Qualitäts-/Sicherheitsprozesse). Informationen zu geistigem Eigentum, Genehmigungen, öffentlicher Akzeptanz und Umweltauswirkungen sind ebenfalls erforderlich. Ein Projektdiagramm, das die Beziehungen der Stakeholder veranschaulicht, wird erwartet.
- Risikomanagement: Beschreibt die kritischen Risiken und die Strategie zu deren Bewältigung unter Bezugnahme auf den Geschäftsplan und die Machbarkeitsstudie.
- Reproduzierbarkeit (Abschnitt 5): Beschreibt das Potenzial des Projekts für eine breitere Anwendung. Dies umfasst die Bewältigung von Ressourcenengpässen (z. B. kritische Rohstoffe, Biomasse) durch Effizienz oder Kreislaufwirtschaft, das Potenzial für positive Umweltauswirkungen über die Treibhausgasreduzierung hinaus (z. B. Biodiversität, Schadstoffreduzierung) und das Potenzial für den Einsatz an anderen Standorten oder in der gesamten Wirtschaft. Die erwartete Emissionsvermeidung durch Replikation muss quantifiziert werden. Es umfasst auch den Beitrag zur industriellen Führungsrolle und Wettbewerbsfähigkeit Europas. Pläne für Wissensaustausch, Kommunikation, Verbreitung und die Sicherstellung der Sichtbarkeit der EU-Förderung werden hier skizziert.
- Versorgungssicherheit und Abhängigkeitsbekämpfung (Abschnitt 6, n. z. B. für NZT-Aufruf): Erläutert den Beitrag des Projekts zur Sicherung von Lieferketten und Reduzierung von Abhängigkeiten gemäß Ausschreibungsdokument.
- Kosteneffizienz (Abschnitt 7): Erfordert eine Berechnung des Kosteneffizienzverhältnisses (Gesamtbetrag der beantragten Förderung + sonstige öffentliche Förderung / absolute Treibhausgasvermeidung über 10 Jahre). Hierzu sind detaillierte Berechnungen der relevanten Kosten unter Verwendung der bereitgestellten Vorlage für die Finanzinformationsdatei einzureichen und die verwendete Methodik (z. B. Standard- oder Referenzanlage) zu erläutern. Der maximale Zuschuss darf 60% der relevanten Kosten nicht überschreiten.
- Bonuspunkte (Abschnitt 8, n. z. B. für BATTERIEN-Anruf): Befasst sich mit etwaigen anwendbaren Bonuspunkten, die im Ausschreibungsdokument erwähnt werden und einer Begründung bedürfen.
- Arbeitsplan, Arbeitspakete, Aktivitäten, Meilensteine, Ergebnisse und Zeitplan (Abschnitt 9): Bietet eine detaillierte Aufschlüsselung des Ausführungsplans des Projekts.
- Arbeitsplanübersicht: Eine Liste oder ein Diagramm aller Arbeitspakete (WPs) mit Dauer, Liefergegenständen und Meilensteinen.
- Arbeitspakete: Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Arbeitspakete. Arbeitspakete sind wichtige Unterteilungen mit Zielen, Aktivitäten, Meilensteinen und Ergebnissen. Zu den obligatorischen sequenziellen Arbeitspaketen gehören: Bis zum Finanzabschluss (Arbeitspaket 1), Zwischen Finanzabschluss und Inbetriebnahme (Arbeitspaket 2) und jährliche Arbeitspakete für die Betriebs-/Berichtsphase (Jahre 1–3 oder 1–X, je nach Ausschreibung). Durch Unterteilung können zusätzliche Arbeitspakete erstellt werden.
- Aktivitäten: Spezifische Aufgaben innerhalb jedes WP, die die Beteiligung der Teilnehmer (Koordinator, Begünstigter usw.) zeigen. WP1 sollte die für den Finanzabschluss erforderlichen Dokumente detailliert aufführen.
- Meilensteine und Ergebnisse: Meilensteine sind wichtige Kontrollpunkte. Zu den obligatorischen Meilensteinen, die Zahlungen auslösen, gehören der Finanzabschluss (Ende von WP1), die Inbetriebnahme (Ende von WP2) und die jährliche Treibhausgasberichterstattung (Ende der operativen WPs). Nachweise für Meilensteine sind erforderlich. Liefergegenstände sind Projektergebnisse, die zum Nachweis des Projektfortschritts eingereicht werden, mit festgelegten Fälligkeitsterminen und Verbreitungsstufen (öffentlich, vertraulich, EU-Verschlusssache). Spezifische obligatorische Liefergegenstände sind im Ausschreibungsdokument aufgeführt.
- Budget und Zeitplan: Verweist auf das detaillierte Budget/den entsprechenden Kostenrechner und erfordert einen beigefügten Zeitplan/ein Gantt-Diagramm.
- Sonstiges (Abschnitt 10): Enthält normalerweise Abschnitte zu Ethik und Sicherheit, die in der Vorlage oft als „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet sind.
- Erklärungen (Abschnitt 11): Beinhaltet Bestätigungen hinsichtlich Patenten, Verbot der Doppelfinanzierung (Bestätigung, dass keine anderen EU-Zuschüsse dieselben Kosten decken), Zustimmung zur Beurteilung einer möglichen Projektentwicklungshilfe (PDA) durch die EIB, Zustimmung zur Berücksichtigung bei nationalen Finanzierungsprogrammen (Weitergabe des Vorschlags an die nationalen Behörden) und Zustimmung zur Weitergabe grundlegender Projektinformationen an die Mitgliedstaaten.
Einreichung und Anlagen
- Der Antrag muss vom Konsortium vorbereitet und von einem Vertreter vor Ablauf der Frist online über das Portal eingereicht werden.
- Zu den obligatorischen Anhängen gehören die detaillierte Budgettabelle/der relevante Kostenrechner (Finanzinformationsdatei) und ein Zeitplan/Gantt-Diagramm. Weitere Anhänge wie die Machbarkeitsstudie, der Geschäftsplan und das Finanzmodell sind als Teil der Abschnitte von Teil B erforderlich.
Diese detaillierte Aufschlüsselung bietet einen umfassenden Überblick über die Anforderungen und den Aufbau des Antragsformulars für den EU-Innovationsfonds basierend auf dem bereitgestellten Musterdokument. Antragsteller sollten stets das spezifische Ausschreibungsdokument und die Live-Formulare im Funding & Tenders Portal konsultieren, um die aktuellsten und genauesten Informationen zu erhalten.
Erstellen eines umfassenden Geschäftsplans für Anträge auf Innovationsfonds
Das bereitgestellte Dokument enthält eine Vorlage für einen detaillierten Geschäftsplan, der im Rahmen eines Antrags beim Innovationsfonds eingereicht werden kann. Die Verwendung dieser Vorlage wird empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Antragsteller müssen jedoch sicherstellen, dass sie einen vergleichbaren Detaillierungsgrad und vergleichbare Informationen für eine gründliche Bewertung bereitstellen. Sollte ein Abschnitt nicht zutreffend sein, ist dies zu kennzeichnen und zu begründen.
Dieser Geschäftsplan dient als wichtiges Instrument zur Bewertung der Realisierbarkeit, der finanziellen Solidität und des Gesamtpotenzials eines geplanten Finanzierungsprojekts. Er erfordert eine eingehende Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Projekts, vom Kernkonzept bis hin zu Risikomanagementstrategien.
- Projektidentifikation
Der Plan beginnt mit der grundlegenden Identifizierung des Projekts, die die klare Angabe des vollständigen Projektnamens und seines Akronyms erfordert.
- Geschäftsvorschlag
Dieser Kernabschnitt erfordert eine klare Formulierung des Business Case des Projekts:
- Produkt- oder Geschäftskonzept: Beschreiben Sie das zugrunde liegende Geschäftsmodell, den einzigartigen Wertbeitrag des Projekts im Vergleich zu bestehenden Lösungen und seine Ausrichtung auf die Gesamtstrategie des Unternehmens.
- Zielmarkt und Marktpotenzial: Geben Sie einen Überblick über den allgemeinen Markt und das spezifische Marktpotenzial, auf das das Projekt abzielt. Dazu gehört eine Darstellung des relevanten regulatorischen Umfelds und eine Erläuterung, wie das Projekt Marktlücken schließt, neue Nachfrage oder Märkte generiert, bestehende erweitert oder den Mehrwert bestehender Produkte/Dienstleistungen steigert.
- Kommerzialisierungsstrategie und Marktakzeptanz: Beschreiben Sie detailliert die erwartete Nachfrage nach den vorgeschlagenen Produkten oder Dienstleistungen, identifizieren Sie wichtige Kundensegmente und diskutieren Sie alle potenziellen Markteintrittsbarrieren.
- Wettbewerbslandschaft: Beschreiben Sie die wichtigsten Wettbewerber und alternativen Lösungen, die derzeit auf dem Markt sind.
- Finanzielle Annahmen
Transparenz und Begründung sind in diesem Abschnitt entscheidend. Antragsteller müssen die Annahmen hinter ihren Finanzprognosen erläutern:
- Abbauen: Geben Sie die erwarteten Einnahmen, Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebsausgaben (OPEX) detailliert an, wie sie in der beigefügten Finanzinformationsdatei und im detaillierten Finanzmodell des Antragstellers verwendet werden. Die Prognosen müssen die gesamte Projektlaufzeit abdecken.
- Eventualitäten: Fügen Sie eine detaillierte Begründung für alle Eventualitäten bei, die auf die CAPEX- und OPEX-Schätzungen angewendet werden.
- Zugrundeliegende Daten: Erläutern Sie Annahmen zu Mengen und Preisen in Bezug auf Abnehmer, Lieferanten und Auftragnehmer. Wichtig ist, dass Sie präzise Verweise auf Belege (wie Machbarkeitsstudien oder Vertragsbedingungen) angeben, die diese Annahmen untermauern. Eine Übersichtstabelle mit den wichtigsten Parametern (Wert, Einheit, Begründung, Dokumentenreferenz) ist erforderlich.
- Projektpartner und Vertragsstrategie
Es ist wichtig, das Ökosystem des Projekts zu verstehen:
- Projektdiagramm: Fügen Sie ein Diagramm bei, das die Beziehungen zwischen allen Projektbeteiligten (Sponsoren, Anteilseigner, Kreditgeber, Abnehmer, Lieferanten, Auftragnehmer, Berater, Versicherer usw.) und dem Projekt selbst veranschaulicht. Falls eine Zweckgesellschaft (SPV) eingesetzt wird, sollte dies angegeben werden. Rechtliche und vertragliche Beziehungen sollten dargelegt werden.
- Beschreibung der Projektpartner: Beschreiben Sie jede Gegenpartei, ihre Rolle, ihren Beitrag und ihre technische, finanzielle und kommerzielle Lage (einschließlich Erfolgsbilanz, wichtiger Finanzdaten und Kreditratings, sofern verfügbar).
- Robustheit und Strategie zur Sicherung von Verträgen: Erläutern Sie die wichtigsten Bedingungen indikativer oder gesicherter Liefer-, Bau- und Abnahmeverträge. Erläutern Sie die Strategie und den aktuellen Stand zur Sicherung aller für die Betriebsphase erforderlichen wichtigen Handelsverträge.
- Detaillierte Cashflow-Prognosen und Projektrentabilität
In diesem Abschnitt geht es um die finanzielle Leistung des Projekts:
- Cashflow-Prognosen: Beschreiben Sie die Cashflow-Prognosen des Projekts, wie sie in den Ausgabeblättern der Finanzinformationsdatei dargestellt sind.
- Erwartete Projektrentabilität: Erläutern Sie die Realisierbarkeit des Projekts anhand von Berechnungen des Nettogegenwartswerts (NPV) und des internen Zinsfußes (IRR) vor und nach der beantragten Förderung durch den Innovationsfonds, geschätzt über die gesamte Projektlaufzeit. Begründen Sie die verwendeten gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) und die Erreichbarkeit des angenommenen Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses.
- Sensitivitätsanalyse
Bewerber müssen beurteilen, wie sich die identifizierten Schlüsselrisiken auf die Rentabilität des Projekts (NPV oder IRR) auswirken, und ein Verständnis für potenzielle finanzielle Schwachstellen nachweisen.
- Finanzierungsplan
Es ist eine klare Darstellung der Finanzierung des Projekts erforderlich:
- Finanzierungsquellen und -verwendung: Beschreiben Sie die Finanzierungsquellen des Projekts (Eigenkapital, Fremdkapital, öffentliche Zuschüsse) und deren Verwendungszweck. Achten Sie dabei auf die Übereinstimmung mit der Übersicht in der Finanzinformationsdatei. Geben Sie für jede Finanzierungsquelle Art, Betrag und Anbieter an.
- Finanzierungsstruktur: Erläutern Sie den Plan zur Kapitaleinlage, Einzelheiten zur Fremdfinanzierung (Unternehmens- oder Projektebene, Rückgriffsebene) und begründen Sie die erwarteten Kreditbedingungen anhand der Projektrisiken und Cashflows. Legen Sie nach Möglichkeit unterstützende Schreiben von Geldgebern vor.
- Zuteilung des Zuschusses aus dem Innovationsfonds: Erläutern Sie, wie sich die Pauschalaufteilung des beantragten Zuschusses proportional zu den Aktivitäten, Arbeitspaketen und Projektmeilensteinen verhält.
- Projektfinanzierer und Investorenengagement
Der Nachweis einer soliden finanziellen Ausstattung ist unerlässlich:
- Beschreibung der Finanzierungsparteien: Beschreiben Sie jeden Finanzierungsgeber, seinen Beitragsbetrag und die finanzielle Lage der Projektbeteiligten (unter Bezugnahme auf die eingereichten Jahresabschlüsse).
- Förderbedingungen und Strategie zur Finanzierungssicherung: Beschreiben Sie detailliert den Status der Sicherung aller Finanzierungsquellen. Beschreiben Sie die Förderbedingungen der einzelnen Geldgeber und die Eigentümerstruktur. Referenzdokumente (MoUs, LoIs, Verpflichtungserklärungen) bestätigen die Glaubwürdigkeit und das Engagement der Geldgeber. Bei Projekten mit geringerer Rentabilität oder höherem Risiko ist ein glaubwürdiger Nachweis der Unterstützung der Aktionäre während des gesamten Projektlebenszyklus, einschließlich der Deckung möglicher Defizite, entscheidend.
- Zeitplan für den Finanzabschluss: Begründen Sie den geplanten Termin für den Finanzabschluss, skizzieren Sie erreichte Meilensteine und ausstehende Aufgaben und zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, die im Ausschreibungsdokument festgelegten Termine einzuhalten.
- Risikoanalyse und -management
Eine gründliche Risikobewertung ist zwingend erforderlich:
- Geschäftsrisiken: Identifizieren und beschreiben Sie die Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsplan, die die Rentabilität beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie dazu das bereitgestellte Tabellenformat (Risikonummer, Art, Beschreibung, Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Eigentumsverhältnisse, Minderungsmaßnahmen).
- Finanzierungsrisiken: Identifizieren und beschreiben Sie auf ähnliche Weise die Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Finanzierungsplan mithilfe eines Tabellenformats und geben Sie auch einen Überblick über etwaige Notfallfinanzierungsquellen.
- Risiko-Heatmap: Fügen Sie eine visuelle Risiko-Heatmap ein, die die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung der wichtigsten identifizierten Risiken zusammenfasst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorlage für den Businessplan des Innovationsfonds eine umfassende, gut dokumentierte und realistische Darstellung des Business Case, der Finanzstruktur und der Risikolandschaft des Projekts erfordert. Für eine erfolgreiche Bewerbung ist es entscheidend, jeden Abschnitt mit dem erforderlichen Detaillierungsgrad zu behandeln.
EIC STEP Scale-Up: Die ersten Gewinner des Jahres 2025 erhalten Eigenkapitalinvestitionen des EIC-Fonds
Die Ausschreibung „Scale Up“ der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) der Europäischen Kommission bietet vielversprechenden, innovationsgetriebenen Unternehmen, die sich bedeutende Investitionsrunden sichern und ihr Wachstum beschleunigen möchten, eine große neue Chance. Am 3. Aprilrd2025 gab die Kommission das Ergebnis der ersten Bewerbungsrunde bekannt. Von den 34 eingegangenen Vorschlägen wurden 22 Unternehmen zu einem ausführlichen Bewertungsgespräch mit einer Jury eingeladen. Sieben Unternehmen erfüllten alle Kriterien für direkte Investitionsentscheidungen des EIC-Fonds, vorbehaltlich der üblichen Due Diligence. Zusätzlich werden vier Unternehmen für ihre Exzellenz mit dem STEP-Siegel ausgezeichnet, das ihnen hilft, ihre Glaubwürdigkeit weiter zu stärken und Ressourcen im Deep-Tech- und Tech-Scale-Up-Ökosystem zu mobilisieren. Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick über die Ergebnisse, die Programmziele, den Auswahlprozess und den weiteren Kontext der STEP-Scale-Up-Ausschreibung.
Hintergrund und Zweck des STEP Scale Up Calls
Die Einführung der Ausschreibung „Scale Up“ der EIC Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) ist eine der entschlossensten Bemühungen der Europäischen Kommission, Europas Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität in kritischen Technologiebereichen zu stärken. Sich rasch entwickelnde Marktlandschaften und ein zunehmender globaler Wettbewerb erfordern, dass europäische Startups und Scale-ups in entscheidenden Wachstumsphasen ausreichend hohe Investitionen erhalten. Finanzierungsrunden im Bereich von 50 bis 150 Millionen Euro waren im europäischen Ökosystem oft schwierig zu sichern, was wertvolle innovative Unternehmen dazu zwang, im Ausland Kapital zu suchen oder vorzeitig übernommen zu werden.
STEP Scale Up überbrückt somit dieses „Tal des Todes“, das die meisten Hightech-Unternehmen während oder nach der Marktvalidierung durchmachen. Das Programm fördert agile Entwicklung, schnelle Marktexpansion und eine stärkere Positionierung in strategischen Technologiebereichen – sei es Deep-Tech, Quantentechnologien, KI, Fusionsenergie, fortschrittliche Materialien oder weltraumbezogene Innovationen. Durch Investitionen zwischen 10 und 30 Millionen Euro pro Unternehmen (mit der Absicht, zusätzliche private Koinvestitionen zu mobilisieren) soll die neue Ausschreibung den Begünstigten helfen, die für ein echtes Scale-up notwendigen höheren Finanzierungsrunden zu erreichen.
Die ersten Ergebnisse von 2025
Die erste Reihe von Einreichungen für die EIC STEP Scale Up-Ausschreibung brachte die folgenden Ergebnisse auf hoher Ebene hervor:
• Einsendeschluss der ersten Runde: Anfang 2025
• Gesamtzahl der eingereichten Vorschläge: 34
• Anzahl der zu Vorstellungsgesprächen eingeladenen Unternehmen: 22
• Für die Investitionsentscheidungen ausgewählte Unternehmen: 7
• Empfänger des STEP-Siegels: 11 (dazu gehören die 7 Kandidaten für eine Investitionsentscheidung sowie 4 weitere Unternehmen mit hoher Punktzahl)
Allein diese Zahlen zeigen, dass die Ausschreibung sehr wettbewerbsintensiv ist. Die Gesamterfolgsquote von der Angebotseinreichung bis zur Investitionsempfehlung liegt bei etwa 20,61 TP27T. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Bewertungsphasen zeigt sich eine Erfolgsquote von etwa 63,71 TP27T vom schriftlichen Angebot bis zum Bewerbungsgespräch. Vom Bewerbungsgespräch bis zur endgültigen Auswahl wurden etwa 31,81 TP27T der befragten Unternehmen für Investitionen empfohlen. Diese Prozentsätze verdeutlichen den strengen Auswahlprozess:
• Vorschlag zum Vorstellungsgespräch: 63.7%
• Erfolgsquote bei Vorstellungsgesprächen (bis zur Empfehlung für eine Finanzierung): 31.8%
• Gesamterfolgsrate: 20.6%
Dieser mehrstufige, äußerst selektive Prozess stellt sicher, dass nur die Unternehmen mit den stärksten technologischen Grundlagen, den solidesten Geschäftsplänen und dem höchsten Potenzial für positive gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen Zugang zum großen Finanzierungsprogramm von STEP Scale Up erhalten.
Präsentation der STEP Scale-Up-Gewinner
Von den 34 potenziellen Unternehmen haben sieben alle Hürden der Evaluierung überstanden und werden nun dem EIC-Fonds für mögliche Investitionen vorgelegt. Diese Unternehmen repräsentieren die Spitze der europäischen Innovationslandschaft und umfassen fortschrittliche KI-Hardware, saubere Fusionsenergie, Innovationen im Quantencomputing, Weltraumüberwachung und vieles mehr:
Axelera AI (Niederlande)
Axelera AI gilt als führender Anbieter anwendungsspezifischer KI-Hardwarelösungen und konzentriert sich vor allem auf generative KI und Computer Vision Inferenz. Die Plattform des Unternehmens verbessert die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und ermöglicht so den Einsatz der nächsten Generation KI-basierter Anwendungen im großen Maßstab. Durch den Aufbau einer starken Hardware-Software-Integration in Europa ist Axelera AI bestens aufgestellt, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU im KI-Hardware-Wettlauf zu stärken – einem Bereich, der typischerweise von großen außereuropäischen Akteuren dominiert wird.
Focused Energy (Deutschland)
Focused Energy stellt sich einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Bereitstellung sauberer und unbegrenzter Energie. Das Unternehmen nutzt ein Fusionsverfahren aus Meerwasser und Lithium und zählt damit zu den vielversprechendsten Unternehmen im aufstrebenden Fusionsenergiesektor. Bei Erfolg kann die Technologie die CO2-Emissionen deutlich reduzieren, die Energiesicherheit verbessern und die Energiewende in Europa und darüber hinaus maßgeblich vorantreiben.
Infinite Orbits (Frankreich)
Infinite Orbits, Europas erster kommerzieller Anbieter autonomer In-Orbit-Wartung, bietet Satellitenwartung und KI-gestützte Weltraumüberwachung an. Das System kann Betankung, Reparaturen und Wartung im Orbit durchführen, was die Lebensdauer der Satelliten verlängert und Weltraummüll reduziert. Durch die Kombination fortschrittlicher KI-Fähigkeiten mit Luft- und Raumfahrttechnik legt Infinite Orbits den Grundstein für eine nachhaltige und widerstandsfähige Satelliteninfrastruktur, die alles von der Erdbeobachtung bis zur Telekommunikation unterstützt.
IQM Finnland (Finnland)
IQM Finnland ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputer und will eine neue Ära europäischer Souveränität in der Quantentechnologie einläuten. Mit dem Plan, bis 2033 eine Million Qubits zu produzieren, strebt IQM einen massiven Sprung nach vorn in der Rechenleistung an und wird damit Branchen wie die pharmazeutische Forschung, komplexe Modellierung, Logistik und Kryptografie revolutionieren. IQM hat bereits 30 Quantencomputer hergestellt und gehört damit zu den weltweit führenden Unternehmen der Quantenhardware-Technologie.
Pasqal (Frankreich)
Pasqal konzentriert sich auf Full-Stack-Quantencomputing und entwickelt kritische Hard- und Softwarelösungen, die die Simulation komplexer Phänomene branchenübergreifend optimieren. Das Unternehmen nutzt Anwendungen aus den Bereichen Materialdesign, Klimamodellierung und fortschrittliche Verschlüsselung. Pasqals Ansatz basiert auf neutralatombasiertem Quantencomputing, einer Methode, die aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Kohärenzeigenschaften großes Interesse geweckt hat.
Xeltis (Niederlande)
Xeltis ist Pionier bei regenerativen Implantaten, die auf der Grundlage nobelpreisgekrönter Chemie entwickelt wurden. Durch die Stimulierung der natürlichen Geweberegeneration im menschlichen Körper revolutioniert Xeltis die Gefäßchirurgie und andere medizinische Bereiche. Diese Leistung verspricht einen bedeutenden Fortschritt in der minimalinvasiven Therapie und reduziert die mit synthetischen Implantaten verbundenen Komplikationen. Die Technologie kann Krankenhausaufenthalte verkürzen, Folgebehandlungen reduzieren und letztlich Kosten für das Gesundheitssystem sparen, während gleichzeitig die Behandlungsergebnisse verbessert werden.
Zadient Technologies (Frankreich)
Zadient schließt entscheidende Lücken in der europäischen Halbleiter-Lieferkette und strebt den Aufbau einer industriellen Produktion von Siliziumkarbid-Wafern (SiC) an. SiC ist aufgrund seiner höheren Leistungsfähigkeit bei hohen Spannungen und Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichem Silizium ein Grundmaterial für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und Leistungselektronik. Durch die Sicherung einer stabilen Versorgung mit hochreinem SiC kann Europa seine Abhängigkeiten reduzieren, seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und die Widerstandsfähigkeit der Halbleiterfertigung sicherstellen.
Vorstellung der STEP-Siegel-Empfänger
Neben diesen sieben Unternehmen erzielten vier weitere Unternehmen außerordentlich hohe Punktzahlen und legten hervorragende Vorschläge vor. Obwohl sie in dieser Runde aufgrund von Budgetbeschränkungen nicht als Investoren ausgewählt wurden, erhielten sie das STEP-Siegel, das ihre Exzellenz und Eignung für alternative oder ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten auszeichnet. Sie erhalten außerdem Zugang zu den EIC Business Acceleration Services. Diese vier sind:
- Leyden Labs (Niederlande)
- Multiverse Computing (Spanien)
- NETRIS Pharma (Frankreich)
- Prométhée Earth Intelligence (Frankreich)
Der Erhalt des STEP-Siegels kann das Profil eines Unternehmens im Kontakt mit potenziellen Investoren, Industriepartnern und Forschungseinrichtungen deutlich stärken. Diese Anerkennung signalisiert, dass die Unternehmen zwar keine sofortige Finanzierung garantieren, aber die gleichen strengen Bewertungskriterien erfüllen, die die Standards europäischer Innovationsexzellenz definieren.
STEP-Souveränitätssiegel
Das STEP-Siegel ist ein wichtiges Element des Programms und soll Synergien zwischen öffentlichen und privaten Finanzierungskanälen fördern. Zu seinen Kernzielen gehören:
- Signalisierung von Qualität für Investoren: Da jeder Siegel-Empfänger eine umfassende Bewertung seiner Technologie, seines Marktpotenzials, seines Finanzplans und seiner Betriebsstrategie durchlaufen hat, stärkt das Siegel seine Glaubwürdigkeit und Attraktivität für privates Kapital.
- Bereitstellung des Zugangs zu EIC-Netzwerken: Empfänger des STEP Seal erhalten Zugang zu einer Fülle von EIC Business Acceleration Services, darunter die Vermittlung an führende Unternehmen, Schulungsworkshops, Networking-Events und potenzielle weitere finanzielle Möglichkeiten.
- Finanzierungslücken schließen: Unternehmen können das STEP-Siegel nutzen, um weitere EU-Zuschüsse, Darlehen oder Beteiligungsinstrumente zu erhalten, die im Rahmen verschiedener Rahmenwerke verwaltet werden. Dieser multilaterale Finanzierungsansatz stellt sicher, dass auch Unternehmen, die in einer Runde keine direkten EIC-Investitionen erhalten, den Anreiz behalten, die richtige Finanzierungsquelle zu finden.
Erklärung des Kommissars
Die Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation, Ekaterina Zaharieva, unterstreicht, wie STEP Scale Up in die umfassendere Vision für Europa einfließt:
Das STEP Scale Up-Programm ist für wachstumsstarke Unternehmen von entscheidender Bedeutung und bietet die notwendigen Ressourcen, Finanzierungen und fachkundige Beratung, um die Expansion zu beschleunigen. Durch die Erschließung leistungsstarker Netzwerke und strategischer Unterstützung befähigt es Unternehmen, Wachstumsbarrieren zu überwinden, Innovationen anzustoßen und wirtschaftlichen Erfolg zu fördern.
Diese Aussage bringt Geist und Ziel der Initiative auf den Punkt. In einem sich rasch verändernden globalen Umfeld betrachtet die Kommission eine starke unternehmerische Unterstützung als unerlässlich, um technologische Souveränität zu erreichen, Arbeitsplätze zu schaffen und die globale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
STEP Scale-Up-Bedingungen
Mit einem Budget von 300 Millionen Euro im Jahr 2025 – und einer prognostizierten Steigerung auf 900 Millionen Euro im Zeitraum 2025–2027 – trägt die Ausschreibung dazu bei, Europas Investitionslücke im Bereich strategischer Technologien zu schließen. Ein wichtiges Ziel ist die Mobilisierung privater Koinvestitionen durch die Anforderung einer Vorabzusage eines qualifizierten Investors in Höhe von mindestens 20% der gesamten Finanzierungsrunde zum Zeitpunkt der Antragstellung. Unternehmen, die 50 bis 150 Millionen Euro einwerben, benötigen in der Regel mehrere Finanzierungsquellen. Der EIC möchte über das STEP-Programm als wichtiger Ankerinvestor fungieren.
Der Mechanismus funktioniert wie folgt:
- Investitionsticket: 10 bis 30 Millionen Euro pro Unternehmen aus Mitteln des EIC-Fonds.
- Hebelanforderung: Die Gesamtsumme der Runde sollte mindestens 50 Millionen Euro betragen, wobei externe Investoren zu Beginn mindestens 20% abdecken.
- Kontinuierliche Einreichung: STEP Scale Up-Ausschreibungen sind das ganze Jahr über geöffnet. Die Evaluierungssitzungen finden vierteljährlich statt, sodass potenzielle Bewerber die Flexibilität haben, sich zu bewerben, wenn sie bereit sind.
STEP-Auswahlverfahren
Das Auswahlverfahren für die EIC STEP Scale Up-Förderung ist sorgfältig strukturiert, um sicherzustellen, dass jeder Vorschlag nach technischem Wert, wirtschaftlichem Potenzial und strategischer Ausrichtung auf die europäischen Ziele bewertet wird. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Bewertungsschritte:
(1) Einreichung des Vorschlags
• Berechtigte Antragsteller: Ein einzelnes KMU oder kleines mittelständisches Unternehmen (definiert als Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern) aus einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land.
• Von Investoren geleitete Einreichungen: Ein Investor kann im Namen eines berechtigten Unternehmens einen Antrag stellen. Dies ist insbesondere für Unternehmen relevant, die sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit wichtigen Investitionspartnern befinden.
• Schlüsselelemente der Anwendung:
– Vollständiger Geschäftsplan: Maximal 50 Seiten, die Technologie, Marktanalyse, Umsatzprognosen und strategische Ausrichtung abdecken.
– Pitch Deck: Ein prägnantes 15-seitiges Dokument, das das zentrale Wertversprechen, den Zielmarkt, die Zugkraft und den Investitionszeitplan hervorhebt.
– Vorabzusage eines Investors: Ein Schreiben einer qualifizierten Investmentinstitution, das ein anfängliches Marktinteresse und die Bereitschaft zur Kofinanzierung von mindestens 20% der neuen Finanzierung belegt.
– Erklärung zur Eigentümerkontrolle: Klarstellung der Aktionärsstruktur, um sicherzustellen, dass das Unternehmen überwiegend in der EU oder einem assoziierten Land im Besitz und unter der Kontrolle der EU ist.
(2) Vorläufige Beurteilung
• Nach der Einreichung werden die Anträge einer Vorprüfung auf Eignung und Vollständigkeit unterzogen. Dabei wird der KMU- bzw. Mid-Cap-Status, die Einhaltung der Seitenbegrenzungen, das Vorliegen eines Investorenbriefs und die Ausrichtung auf strategische Technologiefelder geprüft.
• Normalerweise werden die Bewerber innerhalb von 4–6 Wochen darüber informiert, ob sie in die Phase des persönlichen oder Online-Jury-Interviews eintreten oder ob Änderungen erforderlich sind.
(3) Jury-Interview
• Bewerber, die die vorläufige Bewertung bestehen, nehmen an einer Jurysitzung teil, die aus bis zu sechs Mitgliedern mit Fachkenntnissen in den Bereichen Risikokapital, wissenschaftliche Forschung, Technologiekommerzialisierung oder Unternehmensinnovation besteht.
• Während dieser Sitzung hält das Führungsteam des antragstellenden Unternehmens eine kurze Präsentation zu dessen Technologie, Geschäftsmodell und Marktaussichten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.
• Jurys bewerten Bewerber anhand von Faktoren wie Marktpotenzial, Differenzierung der Technologie, Skalierungsmöglichkeit und Übereinstimmung mit den Mandaten des EIC und der Kommission.
• Im Einklang mit dem Anspruch des Programms, hochrangige strategische Technologien zu fördern, wird von den Bewerbern auch erwartet, dass sie nachweisen, wie ihre Technologie und ihr Geschäftsmodell die künftige Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit oder Souveränität Europas in einem bestimmten Sektor stärken werden.
(4) Endgültige Entscheidung und Zustellung
• Im Anschluss an die Interviews erhält jedes Unternehmen einen ausführlichen Bewertungszusammenfassungsbericht.
• Die für eine Finanzierung empfohlenen Unternehmen (die „Gewinner“) werden vom EIC-Fonds einer formellen Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Diese rechtliche und finanzielle Prüfung stellt sicher, dass die Investitionsbedingungen den gängigen Risikokapitalpraktiken entsprechen.
• Unternehmen, die die Bewertungskriterien erfüllen, aber nicht für eine sofortige Finanzierung ausgewählt werden, erhalten das STEP-Siegel und Zugang zu Business Acceleration Services.
• Unternehmen, die die Kriterien nicht erfüllen, erhalten umfassendes Feedback, um ihre Vorschläge für zukünftige Einreichungsrunden oder alternative Finanzierungswege zu verfeinern.
Zukunftserwartungen
Der Erfolg der ersten Runde der EIC STEP Scale Up-Ausschreibung bietet einen Einblick in den strategischen Wachstumsmotor, den die Kommission für Europa plant. Mit dem Fokus auf Quantentechnologie, KI, saubere Energie und andere transformative Bereiche investiert der EIC in aufstrebende Knotenpunkte der technologischen Revolution. Zu den voraussichtlichen Auswirkungen dieser Investitionen gehören:
• Verbesserte Sektoren: Die allgemeine Stellung Europas in fortgeschrittenen Innovationssektoren (insbesondere KI-Hardware, Quantentechnologie, Fusionsenergie usw.) dürfte sich verbessern und ein wettbewerbsfähigeres Forschungs- und Vermarktungsumfeld schaffen.
• Talentbindung: Große Investitionsrunden und Scale-up-Aktivitäten helfen europäischen Unternehmen, hochkarätige Talente anzuziehen und zu halten, die sonst in Regionen mit größerer Verfügbarkeit von Risikokapital abwandern würden.
• Gestärkte Lieferketten: Durch die Rückverlagerung zuvor ausgelagerter Prozesse und Ressourcen nach Europa – wie etwa der SiC-Wafer-Produktion – werden kritische Abhängigkeiten von Drittländern minimiert.
• Besserer Zugang zu Märkten: Größere Investitionsrunden verschaffen Unternehmen die Möglichkeit, weltweit zu expandieren, starke Vertriebskanäle aufzubauen und die Produktion in großem Maßstab zu steigern.
Budget
Mit einem Budget von 300 Millionen Euro im Jahr 2025 und Gesamtprognosen von bis zu 900 Millionen Euro für den Zeitraum 2025–2027 setzt sich die Kommission für die Erhaltung und Weiterentwicklung der STEP Scale Up-Plattform ein. Die kontinuierliche offene Ausschreibung mit vierteljährlichen Evaluierungszyklen stellt sicher, dass die Kommission flexibel bleibt und dynamisch auf das Innovationstempo reagiert. Dies steht im Gegensatz zu älteren, starreren Finanzierungsansätzen mit festen Fristen, die möglicherweise nicht mit der Reife oder dem Kapitalbedarf eines Startups übereinstimmen.
So bewerben Sie sich
Unternehmen, die eine Bewerbung für zukünftige Runden der STEP Scale Up-Ausschreibung in Erwägung ziehen, sollten die folgenden Punkte beachten:
• Bereiten Sie eine umfassende Dokumentation vor: Da der Geschäftsplan auf 50 Seiten begrenzt ist, ist es wichtig, alle relevanten Details – Technologie, Markt, IP-Strategie, Wettbewerb, Finanzen und Expansionsstrategien – darzustellen, ohne an Klarheit zu verlieren.
• Sichern Sie sich frühzeitig Zusagen von Investoren: Die Anforderung eines 20% Co-Investment-Letters eines qualifizierten Investors kann einen Engpass darstellen. Frühzeitige Gespräche und die Abstimmung mit Risikokapitalfirmen, Unternehmen oder spezialisierten Fonds können die Einreichung erheblich stärken.
• Betonung der strategischen Relevanz für Europa: Zeigen Sie auf, wie das Wachstum des Unternehmens die wirtschaftliche Führungsrolle Europas untermauert, Abhängigkeiten verringert oder die Souveränität in einem kritischen Technologiesektor sichert.
• Nutzen Sie die EIC Business Acceleration Services: Schon vor der Bewerbung können Unternehmen vom breiteren EIC-Umfeld profitieren und möglicherweise an Veranstaltungen oder Workshops teilnehmen, um ihre Präsentationen zu verfeinern.
• Fokus auf langfristige Auswirkungen: Die Jurys werden genau prüfen, wie das Produkt oder die Dienstleistung über einen mehrjährigen Horizont nachhaltige Auswirkungen – sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich – erzielen kann.
Abschluss
Die Vorstellung der ersten Gruppe aus dem EIC STEP Scale Up-Aufruf lieferte mehrere Erkenntnisse: Europa beherbergt ein florierendes Ökosystem hochambitionierter Unternehmen, die sich Herausforderungen stellen, die hohe technologische Komplexität mit enormen Geschäftsmöglichkeiten verbinden. Die sieben für Investitionen des EIC-Fonds empfohlenen Unternehmen – Axelera AI, Focused Energy, Infinite Orbits, IQM Finland, Pasqal, Xeltis und Zadient Technologies – stehen beispielhaft für Europas Streben nach mehr Eigenständigkeit, strategischer Autonomie und Innovationskraft. Die weiteren vier mit dem STEP-Siegel ausgezeichneten Unternehmen zeigen weiterhin, dass der Kreis potenzieller Empfänger sowohl selektiv als auch robust ist.
Mit einer Gesamterfolgsquote von 20,61 TP27T besteht kein Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der Ausschreibung. Doch selbst für Unternehmen, die nicht in der ersten Instanz ausgewählt werden, stellt das Engagement der Kommission für iterative Unterstützung und Feedback sicher, dass die Vorschläge verfeinert und für weitere Runden berücksichtigt werden können. Dieser zyklische Prozess, kombiniert mit den übergreifenden Unterstützungsleistungen des EIC, fördert einen wirklich europaweiten Ansatz zur Skalierung bahnbrechender Ergebnisse.
Das STEP Scale Up-Programm ist eine zentrale Säule der EU-Bemühungen, große Finanzierungsrunden für neue Technologien zu fördern. Mit der Weiterentwicklung des Programms werden weitere vielversprechende europäische Innovatoren die Voraussetzungen für ihren Erfolg schaffen und eine neue Generation globaler Branchenführer hervorbringen, die das Wachstum vorantreiben, die technologische Führungsrolle der Union stärken und nachhaltige, positive Auswirkungen auf dem Kontinent und darüber hinaus bewirken können.
Für weitere Informationen zur offenen Ausschreibung von STEP Scale Up und zur Einreichung einer Bewerbung sollten potenzielle Unternehmen, Investoren oder Partner das Funding & Tenders Portal nutzen, sich mit den technischen Anforderungen vertraut machen und sich auf die bevorstehenden vierteljährlichen Bewertungsfenster vorbereiten. Damit positionieren sie sich an der Spitze der europäischen Innovation und tragen zur gemeinsamen Vision einer dynamischen, widerstandsfähigen und souveränen europäischen Technologielandschaft bei.
Rohdaten
- Veröffentlichte Ergebnisse: 3. April 2025
- Jahr: 2025
- Runden: 1
- Einreichung von Vorschlägen: 34
- Befragte Unternehmen: 22
- Gewinner: 7
- Erfolgsquote der Vorschläge: 64.7%
- Erfolgsquote bei Vorstellungsgesprächen: 31.8%
- Gesamterfolgsrate: 20.6%
- STEP-Siegel-Empfänger: 11
- STEP-Siegelrate: 32.4%
Die vollständige Liste der STEP Scale-Up-Gewinner
| Unternehmen | Land | Projekt | Finanzierung | STEP-Siegel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Axelera AI | Niederlande | Der führende Anbieter speziell entwickelter KI-Hardwarebeschleunigungstechnologie für generative KI und Computer Vision-Inferenz | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Fokussierte Energie | Deutschland | Fusionsbrennstoff für die saubere Energieerzeugung, gewonnen aus Meerwasser und Lithium | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Unendliche Umlaufbahnen | Frankreich | Europas erster kommerzieller Anbieter autonomer In-Orbit-Wartung und KI-gestützter Weltraumüberwachung | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| IQM Finnland | Finnland | Führender Anbieter von Quantencomputern mit einem Produktionsmeilenstein von 30 Quantencomputern und einem Plan zur Erreichung von 1 Million Qubits bis 2033 | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Pasqal | Frankreich | Entwickler einer Full-Stack-Quantencomputertechnologie zur Simulation komplexer Phänomene für wissenschaftliche Entdeckungen | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Xeltis | Niederlande | Entwicklung regenerativer Implantate unter Verwendung nobelpreisgekrönter Chemie, um die Gefäßchirurgie durch natürliche Geweberegeneration zu revolutionieren | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Zadient Technologies | Frankreich | Entwicklung ultrareiner Siliziumkarbid-Materialien (SiC) und hochergiebiger Kristallwachstumstechnologie zur Etablierung der ersten SiC-Wafer-Produktion im industriellen Maßstab in Europa – ein Eckpfeiler für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und die Widerstandsfähigkeit von Halbleitern | Eigenkapital | Ja | 2025 |
| Leyden Labs | Niederlande | / | Keiner | Ja | 2025 |
| Multiversum-Computing | Spanien | / | Keiner | Ja | 2025 |
| NETRIS Pharma | Frankreich | / | Keiner | Ja | 2025 |
| Prométhée Earth Intelligence | Frankreich | / | Keiner | Ja | 2025 |
Um
Die Artikel gefunden auf Rasph.com spiegeln die Meinungen von Rasph oder seinen jeweiligen Autoren wider und spiegeln in keiner Weise die Meinungen der Europäischen Kommission (EC) oder des Europäischen Innovationsrats (EIC) wider. Die bereitgestellten Informationen zielen darauf ab, wertvolle Perspektiven auszutauschen und können Antragsteller potenziell über Zuschussfinanzierungsprogramme wie EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition oder verwandte Programme wie Innovate UK im Vereinigten Königreich oder den Small Business Innovation and Research Grant informieren ( SBIR) in den Vereinigten Staaten.
Die Artikel können auch eine nützliche Ressource für andere Beratungsunternehmen im Zuschussbereich sowie für professionelle Zuschussantragsteller sein, die als Freiberufler angestellt sind oder Teil eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) sind. Das EIC Accelerator ist Teil von Horizont Europa (2021-2027), das vor Kurzem das vorherige Rahmenprogramm Horizont 2020 ersetzt hat.
Dieser Artikel wurde geschrieben von ChatEIC. ChatEIC ist ein EIC Accelerator-Assistent, der Sie beim Verfassen von Vorschlägen beraten, aktuelle Trends diskutieren und aufschlussreiche Artikel zu verschiedenen Themen erstellen kann. Die von ChatEIC verfassten Artikel können ungenaue oder veraltete Informationen enthalten.
- Kontaktiere uns -
EIC Accelerator Artikel
Alle berechtigten EIC Accelerator-Länder (einschließlich Großbritannien, Schweiz und Ukraine)
Erläuterung des Wiedervorlageprozesses für EIC Accelerator
Eine kurze, aber umfassende Erklärung des EIC Accelerator
Der One-Stop-Shop-Finanzierungsrahmen des EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Entscheidung zwischen EIC Pathfinder, Transition und Accelerator
Ein Gewinnerkandidat für das EIC Accelerator
Go Fund Yourself: Sind EIC Accelerator-Eigenkapitalinvestitionen notwendig? (Vorstellung von Grant+)
Tiefer graben: Der neue DeepTech-Schwerpunkt des EIC Accelerator und seine Finanzierungsengpässe
Zombie-Innovation: EIC Accelerator-Finanzierung für die lebenden Toten
Smack My Pitch Up: Änderung des Bewertungsfokus des EIC Accelerator
Wie tief ist Ihre Technologie? Der European Innovation Council Impact Report (EIC Accelerator)
Steuerung des EIC Accelerator: Erkenntnisse aus dem Pilotprogramm
Wer sollte sich nicht für das EIC Accelerator bewerben und warum
Das Risiko, alle Risiken im Hochrisikoprogramm EIC Accelerator darzustellen
So bereiten Sie eine EIC Accelerator-Wiedereinreichung vor
So erstellen Sie eine gute EIC Accelerator-Bewerbung: Allgemeine Projekthinweise

EIC Accelerator-Ergebnisse – Update Februar 2025 (Stichtag Oktober 2024)
DIE NEUESTEN ERGEBNISSE FINDEN SIE HIER
Die neuesten Finanzierungsergebnisse von EIC Accelerator wurden am 17. Februar 2025 für den Stichtag 3. Oktober 2024 veröffentlicht. Insgesamt 71 innovative Startups und KMU haben sich durch dieses äußerst wettbewerbsintensive Programm, das bahnbrechende Innovationen in Europa und darüber hinaus unterstützen soll, eine Finanzierung gesichert.
Diese Finanzierungsrunde unterstreicht das anhaltende Engagement von European Innovation Council (EIC) bei der Förderung von Deep-Tech- und High-Impact-Unternehmen. Im Folgenden schlüsseln wir die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse aus den neuesten Ergebnissen auf.
Wichtige Highlights der EIC Accelerator-Ergebnisse vom Oktober 2024
- Insgesamt zugewiesene Mittel: 387 Millionen Euro
- Durchschnittliche Förderung pro Unternehmen: 5,45 Millionen Euro
- Gewährte Finanzierungsarten:
- Mischfinanzierung (Zuschuss + Eigenkapital): 56 Unternehmen (78,9%)
- Nur Eigenkapital: 5 Unternehmen (7.0%)
- Nur Zuschuss: 10 Unternehmen (14.1%)
Die anhaltende Dominanz der blended finance-Finanzierung zeigt, dass der EIC bevorzugt Start-ups unterstützt, die Zuschüsse mit Eigenkapitalinvestitionen kombinieren und so eine langfristige Skalierbarkeit sicherstellen.
Aufschlüsselung der Mittelzuweisung
- Zuschussbudget: 161 Millionen Euro
- Eigenkapitalbudget: 226 Millionen Euro
Die beträchtlichen Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 226 Millionen Euro spiegeln die Strategie des EIC wider, vielversprechende Start-ups über die anfängliche Zuschussfinanzierung hinaus zu unterstützen und ihnen so dabei zu helfen, weltweit zu expandieren.
Erfolgsquoten – Ein äußerst wettbewerbsintensiver Prozess
Das EIC Accelerator bleibt eines der wettbewerbsintensivsten Förderprogramme in Europa:
- Erfolgsquote Schritt 2: 36%
- Erfolgsquote Schritt 3: 16%
- Gesamterfolgsquote (von Schritt 2 bis zur endgültigen Auswahl): 5.9%
Dies bedeutet, dass von 100 Bewerbern, die Stufe 2 erreichen, letztendlich weniger als 6 Unternehmen eine Finanzierung erhalten, was den strengen Auswahlprozess des Programms unterstreicht.
Geografische Verteilung der finanzierten Unternehmen
Die 71 ausgewählten Unternehmen kommen aus 16 verschiedenen Ländern und spiegeln die breite europäische Reichweite des EIC Accelerator wider. Die leistungsstärksten Länder in dieser Runde sind:
- Deutschland – 15 Unternehmen (21.1%)
- Niederlande – 11 Unternehmen (15,5%)
- Schweden – 7 Unternehmen (9,9%)
- Spanien – 6 Unternehmen (8,5%)
- Frankreich – 5 Unternehmen (7%)
- Großbritannien – 5 Unternehmen (7%)
- Finnland – 4 Unternehmen (5,6%)
- Israel – 4 Unternehmen (5,6%)
- Belgien – 3 Unternehmen (4.2%)
- Italien – 3 Unternehmen (4.2%)
- Österreich – 2 Unternehmen (2,8%)
- Dänemark – 2 Unternehmen (2,8%)
- Bulgarien, Luxemburg, Polen, Portugal – je 1 Unternehmen (1,4%)
Deutschland und die Niederlande sind Vorreiter
Mit 15 ausgewählten Unternehmen dominiert Deutschland weiterhin die EIC Accelerator-Landschaft, was das starke Startup-Ökosystem und die innovationsgetriebene Wirtschaft des Landes widerspiegelt. Auch die Niederlande behaupten mit 11 finanzierten Startups ihre Position als treibende Kraft für Deep-Tech- und High-Impact-Unternehmen.
Kleinere Ökosysteme gewinnen an Bedeutung
Zwar konnten Länder wie Bulgarien, Luxemburg, Polen und Portugal jeweils nur ein finanziertes Unternehmen für sich gewinnen, doch ihre Präsenz in den Ergebnissen unterstreicht die zunehmende Beteiligung von Startups aus unterschiedlichen europäischen Regionen.
Auswirkungen für zukünftige EIC Accelerator-Bewerber
1. Blended Finance bleibt das bevorzugte Finanzierungsmodell
Fast 79% der finanzierten Unternehmen erhalten eine Mischung aus Zuschüssen und Eigenkapital. Die EIC Accelerator setzt sich weiterhin für langfristige finanzielle Nachhaltigkeit ein. Startups sollten nicht nur das Innovationspotenzial ihrer Technologie unter Beweis stellen, sondern auch ein überzeugendes Geschäftsmodell für die Skalierung durch Eigenkapitalinvestitionen.
2. Die Konkurrenz ist groß – aber der Erfolg von Schritt 2 ist ermutigend
Während die allgemeine Erfolgsquote niedrig ist (5,91 TP27T), weist die Erfolgsquote in Schritt 2 von 361 TP27T darauf hin, dass Bewerber mit einem soliden Geschäftsplan und einer soliden Innovationsstrategie gute Chancen haben, im Auswahlverfahren weiterzukommen.
3. Die europäische Deep-Tech-Landschaft wächst
Die Vielfalt der finanzierten Unternehmen zeigt, dass Innovationen in vielen Branchen und Regionen florieren. Startups aus Ländern mit kleineren Ökosystemen sollten sich nicht entmutigen lassen, da das EIC Accelerator weiterhin vielversprechende Projekte unabhängig vom Standort finanziert.
Abschließende Gedanken
Das EIC Accelerator bleibt eines der renommiertesten Finanzierungsprogramme für Deep-Tech-Startups und innovative KMU in Europa. Die jüngsten Ergebnisse bekräftigen das Engagement des Programms für wirkungsvolle, skalierbare Technologien mit einem starken Fokus auf blended finance und Beteiligungsinvestitionen.
Für Startups, die sich bei zukünftigen Auswahlverfahren bewerben möchten, sind eine sorgfältige Vorbereitung, ein überzeugendes Innovationsprofil und eine klar definierte Vermarktungsstrategie der Schlüssel zum Erfolg.
Was kommt als Nächstes?
- Die nächste Runde der EIC Accelerator-Bewerbungen wird voraussichtlich bald beginnen.
- Startups sollten frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen und dabei sowohl auf technologische Innovation als auch auf kommerzielle Rentabilität achten.
- Bleiben Sie dran für weitere Updates zur sich entwickelnden Landschaft der europäischen Startup-Finanzierung!
Rohdaten
Ticketgröße
- Durchschnittliche Ticketgröße: 5,45 Millionen Euro
- Durchschnittlicher Zuschuss: 2,44 Millionen Euro
- Durchschnittliches Eigenkapital: 3,70 Millionen Euro
Finanzierungsart
- Gemischte Finanzierung: 56 Unternehmen (78,9%)
- Nur Eigenkapital: 5 Unternehmen (7.0%)
- Nur Zuschuss: 10 Unternehmen (14.1%)
- Gesamt: 71 Unternehmen
Budget
- Gesamtbudget; Gesamtetat: 387 Millionen Euro
- Zuschussbudget: 161 Millionen Euro
- Eigenkapitalbudget: 226 Millionen Euro
Termine
- Bewerbungsschluss für Zuschüsse: 3. Oktoberrd 2024
- Datum der Veröffentlichung der Ergebnisse: 17. FebruarTh 2025
Erfolgsraten
- Schritt 2: 431 von 1211 (36%)
- Schritt 3: 71 von 431 (16%)
- Schritt 2 und Schritt 3 kombiniert: 71 von 1211 (5,9%)
Länder
Zu den geförderten Unternehmen zählen Unternehmen aus 16 verschiedenen Ländern:
- Deutschland (15 Unternehmen und 21.1%)
- Niederlande (11 Unternehmen und 15,51 TP27T)
- Schweden (7 Unternehmen und 9,91 TP27T)
- Spanien (6 Unternehmen und 8,51 TP27T)
- Frankreich (5 Unternehmen und 7%)
- Vereinigtes Königreich (5 Unternehmen und 7%)
- Finnland (4 Unternehmen und 5,61 TP27T)
- Israel (4 Unternehmen und 5,61 TP27T)
- Belgien (3 Unternehmen und 4,2%)
- Italien (3 Unternehmen und 4,2%)
- Österreich (2 Unternehmen und 2,81 TP27T)
- Dänemark (2 Unternehmen und 2,81 TP27T)
- Bulgarien (1 Unternehmen und 1,41 TP27T)
- Luxemburg (1 Unternehmen und 1,4%)
- Polen (1 Unternehmen und 1,41 TP27T)
- Portugal (1 Unternehmen und 1,41 TP27T)
Gesamtergebnisse 2024
- Vorgeschlagenes Budget: 675 Millionen Euro
- Tatsächliches Budget: 672 Millionen Euro
- Geförderte Unternehmen: 113
Alle EIC Accelerator Gewinner
| Unternehmen | Akronym | Beschreibung | Land | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EASELINK GMBH | MXI | MXI: MATRIX-LADESCHNITTSTELLE ZUR INTEGRATION VON E-FAHRZEUGEN IN EIN INTELLIGENTES ENERGIESYSTEM | Österreich | 2024 |
| Holloid GmbH | ROLF | Revolutionäre Online-Gärungsüberwachung | Österreich | 2024 |
| NannyML NV | EU-AURA | Europäische Union: Reduzierung und Angleichung der KI-Unsicherheit | Belgien | 2024 |
| VOXELSENSOREN | SPAES | Einzelphotonen-Aktivereignissensor | Belgien | 2024 |
| NOVOBIOM | WASTE2WEALTH | Eine pilzbasierte biotechnologische Plattform für eine wettbewerbsfähige Wiederverwertung von Abfällen aus mehreren Stromströmen. | Belgien | 2024 |
| ENDUROSAT AD | SD-IRS | Softwaredefiniertes integriertes Satellitenkommunikationssystem revolutioniert den Datentransfer aus der erdnahen Umlaufbahn | Bulgarien | 2024 |
| NEURESCUE APS | IMPULS | Bahnbrechende, beispiellose lebensrettende Ausrüstung: Intelligenter Aortenballonkatheter bei Herzstillstand | Dänemark | 2024 |
| TETRAKIT-TECHNOLOGIEN APS | TETRAKIT | Eine neuartige, auf Click-Chemie basierende, universelle Radiomarkierungsplattform, die die Entwicklung theranostischer Radiopharmaka | Dänemark | 2024 |
| SEMIQON TECHNOLOGIES OY | COOL-CHIPS | Cool-Chips – Kryogene CMOS-Chips für die Quanten-, HPC- und Raumfahrtindustrie | Finnland | 2024 |
| Fünfte Innovation Oy | Elementic | Wiederaufbau unserer Welt mit neuen Kohlenstoffelementen, die Gebäude in Kohlenstoffspeicherstrukturen verwandeln | Finnland | 2024 |
| Lumo Analytics Oy | LASO-LIBS | Ermöglichung der mechanischen Analyse von Bohrkernen vor Ort für einen nachhaltigen und effizienten Bergbau | Finnland | 2024 |
| Pixieray Oy | Perfekte Sicht | Erste adaptive Brille, die perfekte Sicht für Menschen mit Kurzsichtigkeit und fortschreitender Alterssichtigkeit bietet | Finnland | 2024 |
| IKTOS | AIR-3D | Iktos Robotics: Integration von KI und Robotik für effizientes Arzneimitteldesign und -entdeckung | Frankreich | 2024 |
| HUMMINK | VOGEL | Bahnbrechende Integration und Lösung bei der Fehlerbehebung | Frankreich | 2024 |
| Baumfrosch-Therapie | C-STEM XL | C-STEM: bahnbrechender Weg zur XL-Skala | Frankreich | 2024 |
| QUABLIE | MCQube | Barrieren im skalierbaren Quantencomputing durchbrechen | Frankreich | 2024 |
| Robeaute | SmartMicroBiopsie | Intelligente Mikroroboter-Biopsie: Ein großer Fortschritt in der Diagnostik von Hirnerkrankungen | Frankreich | 2024 |
| Nature Robots GmbH | A-Stürmer | Autonomes Full Farming für optimierte regenerative und gesunde Landwirtschaft mit Robotik und Deep- Lernen | Deutschland | 2024 |
| SEMRON GmbH | Aloe AI | Bahnbrechender 3D-gestapelter KI-Inferenzchip ermöglicht den Einsatz von LLMs mit mehreren Milliarden Parametern auf Edge-Geräte | Deutschland | 2024 |
| CODASIP GMBH | Codasip CHERI | Codasip CHERI-Technologie für hochsichere Prozessoren | Deutschland | 2024 |
| BioThrust GmbH | ComfyCell | ComfyCell: Neuartiger bionischer Bioreaktor zur industriellen Herstellung von Stamm- und Immunzellen | Deutschland | 2024 |
| LiveEO GmbH | EOinTime | EOinTime: Satellitengestützte Veränderungserkennung und prädiktive Überwachung von Infrastrukturnetzen auf Basis hochentwickelter Auflösungsdaten | Deutschland | 2024 |
| ERWEITERTE BRANCHEN GMBH | FLOW-KI | KI-gestütztes Training im Fabrikarbeitsablauf für Industrie 5.0 | Deutschland | 2024 |
| eleQtron GmbH | MAGISCH | Vollständig integrierte On-Chip-Ionenfalle für fehlertolerantes Quantencomputing | Deutschland | 2024 |
| MetisMotion GmbH | Natur | Der neue Standard für die nachhaltige Elektrifizierung von Antrieben als Beitrag zu einer dekarbonisierten Industrie 5.0 | Deutschland | 2024 |
| Noah Labs GmbH | NL Vox | Noah Labs Vox – Erkennung einer sich verschlimmernden Herzinsuffizienz mit KI-basierter Sprachüberwachung | Deutschland | 2024 |
| INVITRIS | Phactory | Abschließende Entwicklung und kommerzielle Vorbereitung von Phactory™, einer universellen Plattformtechnologie zur Skalierbare phagenbasierte Arzneimittelentwicklung und -produktion | Deutschland | 2024 |
| ATMOS-RAUMFRACHT GMBH | Phönix 2 | Eine neuartige Weltraum-Rückkehrkapsel für Mikrogravitationsexperimente in den Biowissenschaften | Deutschland | 2024 |
| MYOPAX GMBH | Satgeno | SATGENO: Regenerative Genreparaturtherapie bei Muskeldystrophien | Deutschland | 2024 |
| FluIDect GmbH | SpheroScan | Online-Biosensor in Echtzeit zur Überwachung von Bioprozessen und der Lebensmittelproduktion mithilfe der µBeads-Sensortechnologie zur Optimierung von Produktionsprozessen und Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit | Deutschland | 2024 |
| Tracebloc GmbH | Spurenblock | Aufbau der globalen Datenzugriffsschicht für KI: skalierbar, sicher und energieeffizient Entwicklung von KI-Modellen | Deutschland | 2024 |
| Vivalyx GmbH | Vivalyx | Eine bahnbrechende Technologie, die die Konservierung von Spenderorganen revolutionieren und den Organpool für Transplantation | Deutschland | 2024 |
| CYBERRIDGE LTD | CyberRidge - Carmel | Einführung der photonischen Verschlüsselung für Datensicherheit im Post-Quanten-Zeitalter mit dem CyberRidge All-Optical Tarnkappen- und Sicherheitslösung für kohärente optische Hochgeschwindigkeitskommunikation | Israel | 2024 |
| DeepKeep Ltd | DeepKeep | DeepKeep schützt KI-Anwendungen in den Bereichen LLM, Vision, räumliche Sensorik, Mensch-Maschine-Interaktion und Multimodale Modelle mit KI-nativer Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit | Israel | 2024 |
| Lumineszierende Solarenergie | Lava-Wärmekraftmaschine | Die effizienteste Wärmekraftmaschine der Welt: Umwandlung von Wärme in emissionsfreien Strom für Industrie und Geothermie-Anwendungen | Israel | 2024 |
| Magneto-Thrombektomie Lösungen | MGN-2024-10 | Magneto eTrieve Thrombektomiesystem - EIC-Förderantrag | Israel | 2024 |
| NanoPhoria srl | NP-MP1 | Inhalierbare therapeutische Nanoformulierungen zur nicht-invasiven und selektiven Behandlung des erkrankten Herzens | Italien | 2024 |
| STAR-TRIC S.R.L. | StarTric | StarTric – Ein neuartiges transkatheterales medizinisches Gerät zur Behandlung einer Trikuspidalinsuffizienz | Italien | 2024 |
| Aindo srl | SydAi | Eine neuartige Plattform zur Generierung synthetischer Daten, die private, sichere und robuste synthetische Daten für die KI-Nutzung produziert Fälle | Italien | 2024 |
| OQ TECHNOLOGY Sarl | 5NETSAT | Demonstration der 5G-NTN-Satellitenübertragung direkt zum Mobiltelefon im Orbit | Luxemburg | 2024 |
| Brineworks BV | Solewerke | Initiative zur Kohlenstoffentfernung auf Basis von Salzsole und Meerwasser zur Neutralisierung des Flugverkehrs und EMISSIONEN DER SCHIFFFAHRT. EIN WASSEROPTIMIERUNGSPFAD FÜR ERNEUERBARE KEYSTONE-LÖSUNGEN | Niederlande | 2024 |
| C2CA TECHNOLOGY BV | C2CA | Revolutionäre Lösung zur Erschließung der Kreislaufwirtschaft von Beton zu Beton | Niederlande | 2024 |
| Deployment von BV | Deployment durchführen | ERSTE MLOPS INTEGRIERT ECHTZEIT-RISIKOMANAGEMENT, COMPLIANCE UND ERKLÄRBARKEIT, WO DAS KI-MODELL LÄUFT | Niederlande | 2024 |
| CarbonX BV | ECo-AnodeX | Das weltweit erste umweltfreundliche und kostengünstige aktive Anodenmaterial, das zur Massenproduktion bereit ist. Industrieanlagen | Niederlande | 2024 |
| VarmX BV | FOLGEN SIE | Abschließende klinische Entwicklung eines revolutionären rekombinanten menschlichen Proteins zur Verhinderung und Blutungen | Niederlande | 2024 |
| Astrape BV | OPTINET | Revolutionierung von Rechenzentren: Ermöglichung nachhaltiger und hocheffizienter optischer Netzwerke | Niederlande | 2024 |
| Leyden Laboratories BV | PanFlu | PANDEMIEVORBEREITUNG DURCH INTRANASALE VERABREICHUNG VON BREIT WIRKSAMEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN ALLE GRIPPE-STÄMME | Niederlande | 2024 |
| Nextkirney BV | PORTADIALIS | NeoKidney: Hämodialysegerät der nächsten Generation macht Hämodialyse endlich tragbar | Niederlande | 2024 |
| QDI-Systeme | QDBILDUNG | Revolutionäre Röntgen- und kurzwellige Infrarot-Bildgebungstechnologie mit Quantenpunkten | Niederlande | 2024 |
| DELFT CIRCUITS BV | Smoking | Entwicklung von Tuxedo: eine supraleitende Flex-to-PCB-Schnittstellenverbindung für Quantentechnologien | Niederlande | 2024 |
| Veridi Technologies BV | VERIDI | Veridi: KI-gestützte Analyse und Überwachung der Bodenbiodiversität | Niederlande | 2024 |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | CT-03 | Ein neuartiger MCL-1-Degrader zur Förderung der Apoptose in therapieresistenten flüssigen und soliden Tumoren | Polen | 2024 |
| PFx Biotech Lda | HuMiLAF | Menschliches Milchlactoferrin durch Präzisionsfermentation | Portugal | 2024 |
| Esencia Foods Spain SL | Esencia Lebensmittel | Bahnbrechende vegane Vollwertkost durch Myzel-Feststofffermentation | Spanien | 2024 |
| IPRONICS PROGRAMMABLE PHOTONICS, SL | ERREGEN | Erste skalierbare, feldprogrammierbare Photonic Gate Array-Plattform für die Entwicklung photonischer Chips und Rechenzentrums-Switch-Anwendungen | Spanien | 2024 |
| CONNECTA THERAPIEN FR | FRAXCURE | Klinische Studie zum FRAgile-X-Syndrom: Entschlüsselung der wissenschaftlichen Hintergründe dieser seltenen Erkrankung in Europa | Spanien | 2024 |
| MONACO BIOTECH SL | MOA FOODTECH | Umwandlung von Nebenprodukten der Agrar- und Lebensmittelindustrie in hochwertige, nachhaltige Proteine und Zutaten | Spanien | 2024 |
| GLOBAL ECOFUEL SOLUTIONS, SL | ROUTE2FUEL | Bahnbrechende einstufige, energiearme Umwandlungstechnologie zur kosteneffizienten Produktion von Treibhausgasen und zur Einsparung nachhaltiger Brennstoffe aus Abfällen | Spanien | 2024 |
| PREMIUM-FRUCHTBARKEIT | TD-System | Eine neuartige Embryotransfertechnologie zur Verbesserung der Schwangerschaftsraten | Spanien | 2024 |
| AirForestry AB | ADATHA | Automatisiertes Baumerntesystem auf Basis von Drohnen für eine nachhaltige Forstwirtschaft | Schweden | 2024 |
| ENAIRON AB | Airon | Der energieeffizienteste Industrieluftkompressor der Welt | Schweden | 2024 |
| CORPOWER OCEAN AB | CORPACK | CorPack - Schlüsselfertiger Baustein zur Skalierung neuartiger Wellenenergietechnologie in wettbewerbsfähige Wellenfarmen im Versorgungsmaßstab | Schweden | 2024 |
| SAVEGGY AB | KNACKIG | Beschichtung von Obst und Gemüse Reduzierung von Plastikmüll und Erhöhung der Haltbarkeit von Produkten | Schweden | 2024 |
| Superintelligenz Computersysteme SICSAI AB | HYPER | Grundlegendes AGI-Modell für Industrieroboter | Schweden | 2024 |
| AlzeCurePharma AB | NeuroRestore ACD856 | ACD856 - Revolutionierung der Alzheimer-Behandlung durch krankheitsmodifizierende und kognitive Verbesserung der Therapie | Schweden | 2024 |
| Blykalla AB | VERSIEGELUNG | Ein bleigekühlter kleiner modularer Reaktor zur Bereitstellung der nächsten Generation sauberer Energie. | Schweden | 2024 |
| Barocal GmbH | BAROCK | Fortschrittliche barokalorische Systeme für nachhaltige kommerzielle Kühlanwendungen | Großbritannien | 2024 |
| Sparxell UK Limited | BIOSPECTRA | Bioinspirierte, nachhaltige Effekte und Farben auf Pflanzenbasis als Ersatz für alle schädlichen Farbstoffe | Großbritannien | 2024 |
| MOF-TECHNOLOGIEN BEGRENZT | NUACO2 | Nuadas neuartige optimierte MOF-Reaktoren zur CO2-Abscheidung | Großbritannien | 2024 |
| STABLEPHARMA LIMITED | SUFFVSA40C | Skalierung von kühlschrankfreien, bei +40 °C stabilen Impfanfällen | Großbritannien | 2024 |
| PRECISIONLIFE LTD | TRANSZENDIEREN | TRANSFORMATIVE NICHT-INVASIVE KAUSALMECHANOSTIKEN-PLATTFORM ZUR EFFEKTIVEN TRIAGE UND ENDOMETRIOSE BEHANDELN | Großbritannien | 2024 |
Um
Die Artikel gefunden auf Rasph.com spiegeln die Meinungen von Rasph oder seinen jeweiligen Autoren wider und spiegeln in keiner Weise die Meinungen der Europäischen Kommission (EC) oder des Europäischen Innovationsrats (EIC) wider. Die bereitgestellten Informationen zielen darauf ab, wertvolle Perspektiven auszutauschen und können Antragsteller potenziell über Zuschussfinanzierungsprogramme wie EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition oder verwandte Programme wie Innovate UK im Vereinigten Königreich oder den Small Business Innovation and Research Grant informieren ( SBIR) in den Vereinigten Staaten.
Die Artikel können auch eine nützliche Ressource für andere Beratungsunternehmen im Zuschussbereich sowie für professionelle Zuschussantragsteller sein, die als Freiberufler angestellt sind oder Teil eines kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) sind. Das EIC Accelerator ist Teil von Horizont Europa (2021-2027), das vor Kurzem das vorherige Rahmenprogramm Horizont 2020 ersetzt hat.
Dieser Artikel wurde geschrieben von ChatEIC. ChatEIC ist ein EIC Accelerator-Assistent, der Sie beim Verfassen von Vorschlägen beraten, aktuelle Trends diskutieren und aufschlussreiche Artikel zu verschiedenen Themen erstellen kann. Die von ChatEIC verfassten Artikel können ungenaue oder veraltete Informationen enthalten.
- Kontaktiere uns -
EIC Accelerator Artikel
Alle berechtigten EIC Accelerator-Länder (einschließlich Großbritannien, Schweiz und Ukraine)
Erläuterung des Wiedervorlageprozesses für EIC Accelerator
Eine kurze, aber umfassende Erklärung des EIC Accelerator
Der One-Stop-Shop-Finanzierungsrahmen des EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)
Entscheidung zwischen EIC Pathfinder, Transition und Accelerator
Ein Gewinnerkandidat für das EIC Accelerator
Go Fund Yourself: Sind EIC Accelerator-Eigenkapitalinvestitionen notwendig? (Vorstellung von Grant+)
Tiefer graben: Der neue DeepTech-Schwerpunkt des EIC Accelerator und seine Finanzierungsengpässe
Zombie-Innovation: EIC Accelerator-Finanzierung für die lebenden Toten
Smack My Pitch Up: Änderung des Bewertungsfokus des EIC Accelerator
Wie tief ist Ihre Technologie? Der European Innovation Council Impact Report (EIC Accelerator)
Steuerung des EIC Accelerator: Erkenntnisse aus dem Pilotprogramm
Wer sollte sich nicht für das EIC Accelerator bewerben und warum
Das Risiko, alle Risiken im Hochrisikoprogramm EIC Accelerator darzustellen
So bereiten Sie eine EIC Accelerator-Wiedereinreichung vor
So erstellen Sie eine gute EIC Accelerator-Bewerbung: Allgemeine Projekthinweise